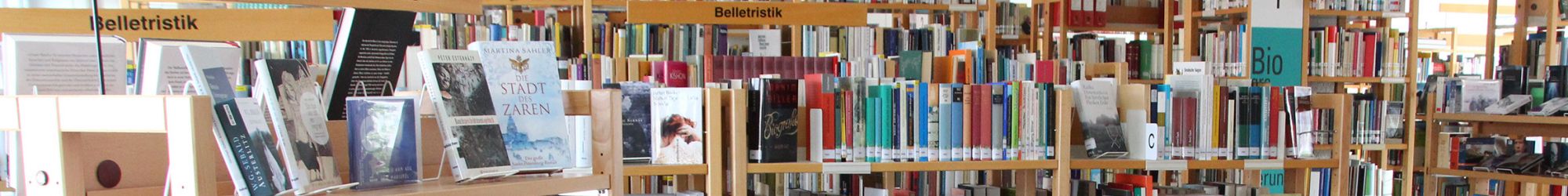Buchtipp des Monats - Belletristik
Jahresarchiv
- Belletristik
- Sachbuch
2021

Sasha Marianna Salzmann
Im Menschen muss alles herrlich sein
Roman
Wie soll man »herrlich« sein in einem Land, in dem Korruption und Unterdrückung herrschen, in dem nur überlebt, wer sich einem restriktiven Regime unterwirft? Wie soll man diese Erfahrung überwinden, wenn darüber nicht gesprochen wird, auch nicht nach der Emigration und nicht einmal mit der eigenen Tochter? »Was sehen sie, wenn sie mit ihren Sowjetaugen durch die Gardinen in den Hof einer ostdeutschen Stadt schauen?«, fragt sich Nina, wenn sie an ihre Mutter Tatjana und deren Freundin Lena denkt, die Mitte der neunziger Jahre die Ukraine verließen, in Jena strandeten und dort noch einmal von vorne begannen. Lenas Tochter Edi hat längst aufgehört zu fragen, sie will mit ihrer Herkunft nichts zu tun haben. Bis Lenas fünfzigster Geburtstag die vier Frauen wieder zusammenbringt und sie erkennen müssen, dass sie alle eine Geschichte teilen.
In ihrem neuen Roman erzählt Sasha Marianna Salzmann von Umbruchzeiten, von der »Fleischwolf-Zeit« der Perestroika bis ins Deutschland der Gegenwart. Sie erzählt, wie Systeme zerfallen und Menschen vom Sog der Ereignisse mitgerissen werden. Dabei folgt sie vier Lebenswegen und spürt der unauflöslichen Verstrickung der Generationen nach, über Zeiten und Räume hinweg. Bildstark, voller Empathie und mit großer Intensität.
Pressestimmen
Zu loben ist die sinnlich konkrete Sprache, die der Fülle der Eindrücke und Gefühle jederzeit gerecht wird. Eigenwillige, allegorisch aufgeladene Bilder kehren wieder und prägen sich ein ... Zu Recht steht 'Im Menschen muss alles herrlich sein' auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.
Wolfgang Schneider, Der Tagesspiegel
Die Multiperspektivität des Geschehens resultiert nicht in bloßer Abwechslung der Fokussierung, sondern in sich überlagernden Blickwinkeln, als setzte Salzmann bei der Inszenierung des Geschehens eine Drehbühne ein. Und je weiter das Buch fortschreitet, desto mehr Fahrt scheint diese Drehbühne aufzunehmen.
Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Schöner kann man vom Schmerz um Verlorenes nicht erzählen.
Maike Albath, Deutschlandfunk Kultur
Sasha Salzmann ist ein fulminantes Buch geglückt ... [das] vor Erzähllust nur so vibriert.
Rainer Moritz, Neue Zürcher Zeitung
[Salzmann] erzählt in einem breiten, zeitlos epischen Stil. Da gibt es eine ruhige Souveränität, die einen schwer hoffen lässt, hier eine der nächsten großen deutschen Erzählerinnen zu lesen.
Marie Schmidt, Süddeutsche Zeitung
[Sasha Marianna] Salzmann erzählt zugewandt, ihren Protagonistinnen wie dem Publikum gegenüber. Als würde sie aus der Einsamkeit, dem Idiosynkratischen des Schreibens ein großes soziales Vertrauen schöpfen.
Juliane Liebert, DIE ZEIT
Eckdaten
Salzmann: Sascha Maria: Im Menschen muss alles herrlich sein. Roman. - Berlin, Suhrkamp, 2021. - 384 Seiten. - ISBN 978-3-518-43010-1
Quelle: https://www.suhrkamp.de
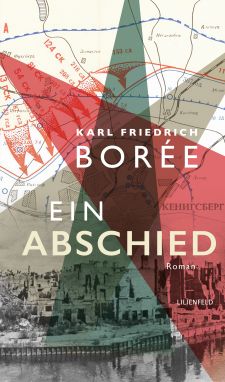
Karl Friedrich Borée
Ein Abschied
Roman
Mitte Januar 1945 steht das schon zerbombte Königsberg kurz davor, von russischen Truppen erobert zu werden. Marian Burgers Hoffnung mitten in der Vernichtung ist ein Neuanfang in Freiheit. Aber dieses Ziel liegt vielleicht unerreichbar in der Ferne. Der Irrsinn der Diktatur bleibt bedrohlich, seine Frau soll noch auf bestmögliche Weise aus der Stadt kommen, eine alte Freundin nicht hilflos zurückgelassen werden. Und auf dem Weg zum rettenden Pillauer Hafen, von dem aus die letzten Schiffe abgehen, wird sein Verantwortungsgefühl noch einmal zusätzlich grausam herausgefordert.
Karl Friedrich Borée hat mit Ein Abschied einen seiner dichtesten Romane geschrieben: kompromisslos, antirevanchistisch und trotzdem melancholisch Abschied nehmend, nah am Zeitgeschehen und berührend. Erneut ein Werk dieses erstaunlichen Autors, das sich zu entdecken lohnt.
Pressestimmen
Karl Friedrich Borée ist wirklich ein ganz ungewöhnlich kluger und nachdenklicher Chronist seiner Zeit. … Und in einer so kruden Welt, in der wir gerade leben, wo uns diese Themen wie Anstand und Courage, Wahrheit und Rechtsstaat wirklich jeden Tag umtreiben, finde ich es wunderbar, dass es ihn wieder gibt und wir ihn wieder lesen können.
Gabriele von Arnim, Deutschlandfunk Kultur/Lesart
Es ist ein Geschenk, Borée entdecken zu können.
Caroline Fetscher, Der Tagesspiegel
Allein aus sprachlicher Sicht eine echte Entdeckung…
Anja Hirsch, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Zeitlos sind die zentralen Fragen, die dieser kluge Roman stellt: Wie verhalten sich Menschen, wenn sich in historischen Krisenzeiten die bürgerliche Ordnung um sie herum auflöst? Wie findet der Einzelne trotz Terrorregime einen moralisch vertretbaren Weg zwischen Anpassung und Aufbegehren? Wann kippt das persönliche Freiheitsbedürfnis in Verantwortungslosigkeit? Die geglückte Verbindung des Historisch-Dokumentarischen mit solchen bis heute hochaktuellen Fragestellungen und moralphilosophischen Erkundungen macht Ein Abschied zu einer sehr lesenswerten Wiederentdeckung.
Wolfgang Schneider, Deutschlandfunk/Büchermarkt
'Ein Abschied' verdient mehr als eine flüchtige posthume Würdigung, es ist ein zeitloser, starker Roman, nicht nur ein humanistisches Lehrstück. Der Roman stellt unbequeme Fragen, die nicht einfach beantwortet werden können, und ist gerade im Zeitalter des Populismus aktueller und wertvoller denn je.
Marcela Drumm, WDR 5/Scala
Die Romane von Karl Friedrich Borée dürften für alle Literaturliebhaber Schatzkisten sein. Beim Schmökern finden sich neben wertvollen Erinnerungen und sprachlichem Können auch humanistische Anschauungen, die inzwischen nicht mehr vorausgesetzt werden dürfen.
Sabine Bovenkerk-Müller, schreiblust-leselust.de
Es sind erschütternde Bilder und Szenen, die der Autor uns vor Augen führt. Eindringlich, unglaublich dicht und anschaulich schildert Borée die letzten Tage in Königsberg auf sehr hohem literarischen Niveau. Mit Karl Friedrich Borée hat der Düsseldorfer Lilienfeld Verlag einen ganz großartigen deutschen Erzähler wiederentdeckt. … Ich empfehle dieses Buch …, denn es vermittelt uns wieder einen Blick auf die wesentlichen Dinge des Lebens. Und ganz besonders ist die Lektüre auch für junge Menschen geeignet, die Krieg und Not eigentlich nur noch vom Hörensagen kennen … Prädikat: Ein ganz, ganz besonders Buch!
Katrin Bartsch, Leseempfehlung der Buchhandlung Goltsteinstraße Köln
Borées 'Ein Abschied' ist kein Geschenk, es ist ein Muss für jeden humanistisch denkenden und handeln-wollenden Menschen. … Seine ausgefeilte Sprache und die seinem Protagonisten Marian Burger auferlegten Gedanken sind ein ästhetisches und philosophisches Husarenstück. Ein Abschied, ein Roman, an dem sein Leser wächst! Einfach großartig und vielleicht gerade zur richtigen Zeit wieder veröffentlicht!
Joachim Warminski, Buchhandlung Friebe, Berlin
Eckdaten
Borée, Karl Friedrich: Ein Abschied. Roman. Mit einem zusätzlichen Text von Karl Friedrich Borée und einem Nachwort von Axel von Ernst. - Düsseldorf: Lilienfeld Verlag, 2019. – 184 Seiten. - ISBN 978-3-940357-77-9
Quelle: Lilienfeld Verlag
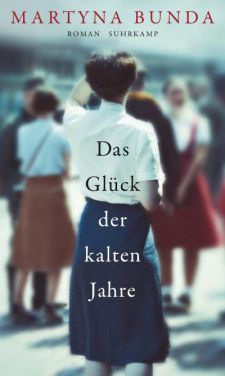
Martyna Bunda
Das Glück der kalten Jahre
Roman
Ob ihr Mann das Meer gesehen hat, bevor er 1932 auf der Großbaustelle der Hafenstadt Gdingen tödlich verunglückte, wird Rozela nie erfahren. Von der staatlichen Entschädigung baut sie für sich und die drei Töchter ein Steinhaus mit Doppelfenstern, im kaschubischen Dorf eine Sensation. Dort überstehen sie die Schrecken des Krieges. Als die sowjetische Armee gen Westen zieht, bietet das Haus keinen Schutz mehr. Im Keller versteckt, muss Gerta, die älteste, mit anhören, wie ihre Mutter von Soldaten vergewaltigt wird. Aber die Maxime der Mutter lautete stets: Kopf oben behalten, egal was passiert. Dies beherzigen auch die Töchter, allen voran die leidenschaftliche, lebenshungrige Truda, Sachbearbeiterin im Schifffahrtsamt, deren Mann für Jahre im Gefängnis des Geheimdiensts verschwindet. Ilda, Motorradfahrerin, arbeitet in der Umsiedlungsbehörde und liiert sich spät – mit einem Bildhauer, der ihr seine Ehe mit einer Deutschen verschweigt. Trotz gelegentlicher Ausbrüche, Zerwürfnisse, Trennungen sind Mutter und Töchter in entscheidenden Momenten füreinander da – vier starke Frauen, die in widrigen Zeiten wie Pech und Schwefel zusammenhalten.
Pressestimmen
Es ist faszinierend mitzuerleben, wie es der Autorin gelingt, uns beim Lesen die Dinge mit den
Augen der Figuren sehen zu lassen. Sie erzählt die Weltgeschichte aus dem vermeintlich Kleinen und
Alltäglichen. Ergreifend.
Magazin Märkische LebensArt
Martyna Bunda erfindet das Genre des Familienromans mit ihrem ›Glück der kalten Jahre‹ gewiss
nicht neu, aber sie liefert ein solides Stück zeitgeschichtlicher Literatur ab, das sich – ebenso gut wie
niveauvoll lesbar – über viele lebhafte Jahrzehnte polnischer Geschichte erstreckt. Dabei sind ihr mit
der Mutter und ihren drei Töchtern starke und prägnante Figuren gelungen. Und der eine oder
andere, geistreich verspielte Einfall bleiben gerne länger im Gedächtnis.
Tobias Wrany, Buchhandlung Jost, Bonn
Die so entstandenen Szenen, Miniaturen fast, sind prallvoll mit Leben und schönen Details. Sie
ziehen mitten hinein in eine fremde und doch vertraute Welt.
Stern
Martyna Bunda gelingt das Kunststück, das Private und das Öffentliche der schwierigen polnischen
Nachkriegszeit in einer Romanerzählung miteinander zu verschränken.«
Ulrich M. Schmid, Neue Zürcher Zeitung
Martyna Bunda zeigt in ihrer eindrucksvollen kaschubischen Frauensaga, wie Rozela und ihre
Töchter sich durchbeißen, wie sie die Herausforderungen des Lebens bestehen, ohne sich je zu
unterwerfen.
Günter Kaindlstorfer, ORF
Der Sog dieses Romans entsteht nicht aus der episodisch erzählten Handlung, sondern aus der
Sprache. Der Übersetzer Bernhard Hartmann hat in seiner sorgfältigen und farbigen Übersetzung
jeder Nuance nachgespürt.«
Sieglinde Geisel, SRF
Wer so erzählen kann, muss eine Menge vom Leben verstehen.
Monika Melchert, Sächsische Zeitung
Ein schönes, ein weises Buch.
Newsweek
Es gelingt ihr vortrefflich, einen leichten Ton voller Witz und Esprit anzuschlagen, aber auch dem
Grauen dieser Zeit eine Stimme zu verleihen. Zusätzlich erzeugen die wechselnden
Erzählperspektiven und Rückblenden gekonnt eine innere und äußere Spannung, die zu fesseln
vermag.
Gabriele Fachinger, ekz.bibliotheksservice
Mit ihrem Roman „Das Glück der kalten Jahre“ schildert Martyna Bunda die jüngste polnische
Geschichte dezidiert aus weiblicher Sicht. Damit widersetzt sie sich dem Frauen- und Familienbild der
nationalkonservativen Regierung, erschafft aber auch eine Art literarischer Programmmusik, in der
der Wille zum Positiven allzu deutlich dominiert.
Katrin Hillgruber, DLF
Eckdaten
Martyna Bunda: Das Glück der kalten Jahre : Roman. Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann. - Berlin: Suhrkamp, 2021.- 317 Seiten.- ISBN 978-3-518-42887-0
Quelle : suhrkamp.de
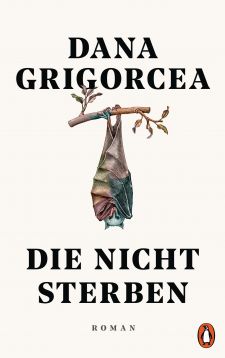
Dana Grigorcea
Die nicht sterben
Roman
Eine junge Bukarester Malerin kehrt nach ihrem Kunststudium in Paris in den Ferienort ihrer Kindheit an der Grenze zu Transsilvanien zurück. In der Kleinstadt B. hat sie bei ihrer großbürgerlichen Großtante unter Kronleuchtern und auf Perserteppichen die Sommerferien verbracht. Eine Insel, auf der die kommunistische Diktatur etwas war, das man verlachen konnte. „Uns kann niemand brechen“, pflegte ihre Großtante zu sagen. Inzwischen ist der Kommunismus Vergangenheit und B. hat seine besten Zeiten hinter sich. Für die Künstlerin ist es eine Rückkehr in eine fremd gewordene Welt, mit der sie nur noch wenige enge Freundschaften und die Fäden ihrer Familiengeschichte verbinden. Als auf dem Grab Vlad des Pfählers, als Dracula bekannt, eine geschändete Leiche gefunden wird, begreift sie, dass die Vergangenheit den Ort noch nicht losgelassen hat – und der Leitspruch ihrer Großtante zugleich der Draculas ist. Die Geschichte des grausamen Fürsten will sie erzählen. Am Anfang befürchtet sie, dass sie die Reihenfolge der Geschehnisse verwechseln könnte. Dann wird ihr klar: Jede Reihenfolge ergibt einen Sinn. Weil es in der Geschichte nicht um Ursache oder Wirkung geht, sondern nur um eines: Schicksal. Inzwischen aber ist es für jede Flucht zu spät.
Pressestimmen
Die nicht sterben, ein politischer Vampirroman. Für mich war‘s Liebe auf den ersten Biss.
Denis Scheck in "Druckfrisch" ARD
Dana Grigorcea ist ein unglaubliches schriftstellerisches Talent. Interessant ist nicht nur die Dracula-Geschichte, sondern auch die Szenen und Bilder, mit denen sie das postkommunistische Rumänien beschreibt. Und in was für einer unglaublich mystischen, physischen Sprache sie es beschreibt!
Milo Rau im Literaturclub des Schweizer Fernsehens
eine so verträumte wie beinharte Schauergeschichte (...) ein fantastischer, aber illusionsfreier, frei flottierender Blick auf Schrecken und Alltag der rumänischen Gesellschaft vor und nach Ceausescu
Judith von Sternburg , Frankfurter Rundschau
Diese Schriftstellerin hat Wichtiges zu erzählen, stochert nicht im Befindlichkeitsnebel der eigenen Identität herum (...) Grigorcea wirbelt vergangenen und aktuellen Horror so geschickt durcheinander, dass ihr literarisches Programm, das man vielleicht Subversion durch Affirmation nennen könnte, am Ende aufgeht.
Carsten Otte , Der Tagesspiegel
Es ist eine kunstvolle Dracula-Geschichte, ein Künstlerinnen-Roman, eine Farce, und das alles erzählt mit großer Sprachkraft.
Ulrich Rüdenauer , SWR 2
Im Vorübergehen zaubert sie eine neue literarische Gattung aus dem Hut, wobei es einen lediglich wundert, dass es sie noch nicht längst gibt: den politischen Schauerroman.
Roman Bucheli , Neue Zürcher Zeitung
(eine) schauerromantisch aufgeladene Groteske, in der die Vergangenheit und die Gegenwart kunstvoll und hochkomisch ineinander verwirbelt sind.
SWR Bestenliste, Mai 2021
Eckdaten
Dana Grigorcea: Die nicht sterben. Roman. – München: Penguin, 2021. - 260 Seiten. - ISBN 9783328601531
Quelle :Penguin Random House
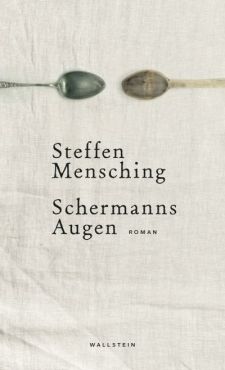
Steffen Mensching
Schermanns Augen
Roman
Eben noch war Rafael Schermann in der Wiener Caféhaus-Szene ein bunter Hund, bekannt mit Gott und der Welt von Adolf Loos, Oskar Kokoschka, Magnus Hirschfeld bis zu Else Lasker-Schüler, Herwarth Walden, Ehrenstein, Döblin, Bruckner, Eisenstein, Stanislawski, Piscator… Selbst der scharfzüngige Karl Kraus erhoffte sich von Schermanns graphologischer Begabung beim Deuten von Briefhandschriften entscheidende Hilfe in seinem Liebeswerben um Sidonie Nádherný…
Und jetzt landet dieser schillernde Mann völlig abgerissen und todkrank als Gefangener am Ende der Welt, hundertfünfzig Kilometer östlich von Kotlas an der Bahntrasse nach Workuta im Lager Artek. Sofort zieht einer, der aus Handschriften Vorhersagen ableiten kann, außerordentliches Interesse auf sich, ob nun das des Lagerkommandanten (selbst der kann nicht sicher sein, ob er morgen Chef eines größeren Lagers sein oder man ihn erschießen wird) oder das seiner Mitgefangenen, »achthundert Männer, zweihundert Frauen. Eine echte sowjetische Großfamilie… jeder weiß alles vom anderen und wünscht ihm die Krätze an den Hals.« Und dann behauptet Schermann noch, kein Russisch zu können, und beansprucht einen Übersetzer. Steffen Mensching stellt ihm den jungen deutschen Kommunisten Otto Haferkorn an die Seite. Das ungleiche Paar, mal Herr und Knecht, mal Don Quijote und Sancho Pansa, kämpft ums Überleben unter brutalen, absurden Verhältnissen im mörderischen Räderwerk des zwanzigsten Jahrhunderts.
Zwölf Jahre hat Steffen Mensching an seinem opus magnum gearbeitet, es ist ein großer Wurf geworden.
(Klappentext)
Ein Gulag-Roman mit deutschen und österreichischen Protagonisten. Eine Rückschau ins Wien der zwanziger Jahre. Ein Roman, der ins Zentrum des 20. Jahrhunderts führt.
Pressestimmen
von einer Sprach- und Beschreibungsdichte, die man seit der „Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss in der deutschsprachigen Belletristik nicht mehr gesehen hat
Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Ich stehe fassungslos vor dieser Leistung. (…) diese Fülle zu entdecken, aufzufinden und dann dieses riesige Wissen zu organisieren, das dann ein richtiger, ein wundervoller Roman wird – alle Preise der Welt gebühren dem Autor.
Christoph Hein, Autor
So gelingt es dem Text ein kulturell-politisches Sittenbild der Zeit zwischen den Kriegen zu zeichnen. Ein wunderbarer Roman
Hans-Michael Marten, MDR »artour«
Dem Leser steht eine faszinierende Lektüre bevor.
Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Mensching (triumphiert) als Erzähler
Christoph Dieckmann, Die ZEIT
Eine Wucht von einem Roman, der seine Leser anregend beschäftigt.
Cornelia Geißler, Frankfurter Rundschau
"Schermanns Augen" ist ein außergewöhnliches literarisches Ereignis.
Michael Opitz, Deutschlandfunk Kultur
Man wird dieses beeindruckende Werk so schnell nicht vergessen können.
Lothar Struck, SWR2 Lesenswert
Sowohl sprachlich als auch inhaltlich der ganz große Wurf.
Ulf Heise, MDR Kultur
Eckdaten
Steffen Mensching: Schermanns Augen. Roman. - Göttingen, Wallstein Verlag, 2018. - 820 Seiten. - ISBN 9783835333383
Quelle : Wallstein Verlag
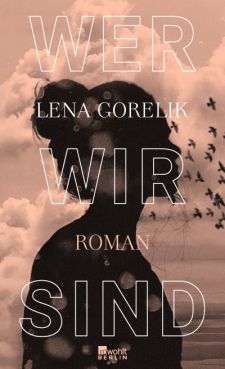
Lena Gorelik
Wer wir sind
Sankt Petersburg/Ludwigsburg 1992. Ein Mädchen reist mit den Eltern, der Großmutter und ihrem Bruder nach Deutschland aus, in die Freiheit. Was sie dafür zurücklässt, sind ihre geliebte Hündin Asta, die Märchen-Telefonnummer und fast alles, was sie mit Djeduschka, Opa, verbindet – letztlich ihre Kindheit. Im Westen merkt die Elfjährige, dass sie jetzt eine andere und «die Fremde» ist. Ein Flüchtlingskind im selbstgeschneiderten Parka, das die Wörter so komisch ausspricht, dass andere lachen. Auch für die Eltern ist es schwer, im Sehnsuchtswesten wächst ihre russische Nostalgie; und die stolze Großmutter, die mal einen Betrieb leitete, ist hier einfach eine alte Frau ohne Sprache. Das erst fremde Deutsch kann dem Mädchen helfen – beim Erwachsenwerden, bei der Eroberung jenes erhofften Lebens. Aber die Vorstellungen, was Freiheit ist, was sie erlaubt, unterscheiden sich zwischen Eltern und Tochter immer mehr. Vor allem, als sie selbst eine Familie gründet und Entscheidungen treffen muss.
Ein autobiographischer Roman, der zeigt, dass die Identität gerade im Zwiespalt zwischen Stolz und Scham, Eigensinn und Anpassung, Fremdsein und allem Dazwischen stark wird. «Wer wir sind» erzählt, wie eine Frau zu sich findet – und wer wir im heutigen Deutschland sind.
Pressestimmen
Eine schwebende, oft beglückende Sprache.
ZDF "Das blaue Sofa Buchmesse", 27. Mai 2021
Es geschieht selten, sehr selten, dass ich ein Buch lese, das mich derart trifft, das so eine eigene Klangfarbe, so eine tiefe Klugheit hat, dass es einem den Atem verschlägt.
Carolin Emcke, Twitter, 20. Mai 2021
Wichtig, spannend und auf jeden Fall sehr lesenswert.
Die Presse, 5. Juni 2021
Lena Gorelik geht mutig und offen an ihre Schmerzstellen, erkundet in wunderbarer Sprache ihre Selbstwerdung, eine sehr persönliche und doch ungemein politische Geschichte.
3Sat "Kulturzeit", 28. Mai 2021
Lena Gorelik schreibt in eindrücklichen Bildern ... Gerade in dem Versuch, unterschiedliche Lebenserfahrungen miteinander in Bezug zu setzen und zu versöhnen, ist 'Wer wir sind' auch ein sehr aktuelles Buch.
MDR, 27. Mai 2021
Man hat das Gefühl, dabei gewesen zu sein, so knisternd beschreibt Lena Gorelik Familienszenen.
NDR Kultur "Neue Bücher", 19. Mai 2021
Was hält Familie zusammen, wenn Hoffnungen, Lebensumstände auseinanderdriften? Für Lena Gorelik sind es tiefe Gefühle, die irgendwann gepflanzt worden sind - und für immer bleiben.
Bayern 2, 19. Mai 2021
Voller Melancholie und auch Poesie ... ein Geschenk.
Bayern 2, 18. Mai 2021
Springt leichtfüßig zwischen zarter Melancholie und trocken-lakonischem Witz.
Münchner Merkur, 18. Mai 2021
Eine herausragende Romanautorin ... 'Wer wir sind' ist Lena Goreliks Geschichte. Sie schenkt sie uns.
Thibaud Schremser, Saarländischer Rundfunk SR 2 Kulturradio, 18. Mai 2021
Eine eigenwillige Liebeserklärung; an die Eltern, die Großeltern, den ertrunkenen Onkel. Gleichzeitig das Zeugnis einer Selbstermächtigung ... Ja, dieses sehr persönliche, in seinen vielen kreisenden Suchbewegungen berührende Buch ist auch eine Liebeserklärung an ein Leben zwischen zwei Sprachen.
SZ Extra, 12. Mai 2021
Lena Gorelik erzählt elegant, fließend und mit viel Witz und Tiefe und ragt aus der Schar der jungen, hervorragenden deutschen Autoren weit heraus.
WDR 5
Eckdaten
Lena Gorelik: Wer wir sind. Roman. - Berlin, Rowohlt Verlag, 2021. - 320 Seiten. - ISBN: 978-3-7371-0107-3
Quelle : rowohlt.de
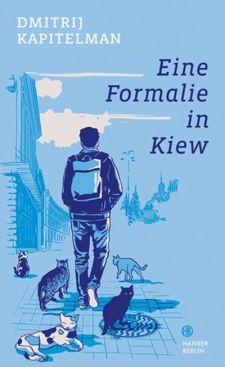
Dmitrij Kapitelman
Eine Formalie in Kiew
Eine Formalie in Kiew ist die Geschichte einer Familie, die einst voller Hoffnung in die Fremde zog, um ein neues Leben zu beginnen, und am Ende ohne jede Heimat dasteht. Erzählt mit dem bittersüßen Humor eines Sohnes, der stoisch versucht, Deutscher zu werden. Dmitrij Kapitelman kann besser sächseln als die Beamtin, bei der er den deutschen Pass beantragt. Er ist dem deutschen Grundgesetz treuer als der Security-Nazi am Eingang der Behörde. Nach fünfundzwanzig Jahren als Landsmann, dem Großteil seines Lebens, wird es Zeit. Höchste Zeit sogar –was, wenn die Faschisten im Osten bald wieder regieren? Aber der Bürokratie ist keine Formalie zu klein, wenn es um Einwanderer geht. Die Beamtin verlangt eine Apostille aus Kiew. Also macht sich Kapitelmann auf die Reise in die Stadt, in der er zur Welt kam und mit der ihn nichts mehr verbindet, außer Kindheitserinnerungen. Schön sind diese Erinnerungen, warten doch darin liebende, unfehlbare Eltern. Und schwer, denn gegenwärtig ist die Familie zerstritten. Bis das Schicksal sie in Kiew wieder zusammenführt.
Pressestimmen
Erst durch dieses Buch ist das Verstehen der Migration, des Nicht-Dazugehörens und des Dazwischen möglich.
Olga Grjasnowa
Dmitrij Kapitelman schreibt über Liebe und Entwurzelung auf eine Art und Weise, die uns allen im Herzen vertraut ist.
Lilly Brett
Kapitelman hat einen wachen Blick und beweist in seinem Roman eine enorme Beobachtungsgabe. Dieses Buch zu lesen ist ein großes Vergnügen. ... ein großes Sprachtalent.
WDR2
Kapitelman verhandelt ... ein Bewusstsein für die Fluidität von Zugehörigkeiten, den Wandel und das Nebeneinander von Identitäten, für Widersprüche, die nur von außen wie Widersprüche wirken.
Sonja Zekri, Süddeutsche Zeitung
Das ist ungeheuer liebevoll ... es ist so, dass es einem die Tränen der Rührung in die Augen treibt. Man möchte diesem Autor danken für diesen wunderschönen Text.
Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur
Es liest sich gut weg. Kapitelmann ... hat einen hat einen eingängigen Sound, den bewies er schon im wunderbaren Debüt "Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters". Auch in der "Formalie" findet er an der richtigen Stelle zärtliche Worte.
Andreas Scheiner, Neue Zürcher Zeitung
Ein sprachliches Feuerwerk. ... Dmitrij Kapitelman erzählt mit viel Humor und sprachlicher Fantasie ...immer wieder erfrischend selbstironisch. ... Er vermittelt auf eindrückliche Weise die prekäre Situation des zwischen den Stühlen sitzenden Migranten, der dazu noch von den ambivalenten Gefühlen gegenüber seinen Eltern gebeutelt wird.
Fokke Joel, Die Tageszeitung
Zum Heulen witzig ... Dieses Buch nimmt mit auf eine sehr persönliche Reise in ein Land, das allen Klischees widerspricht, um einige dann doch, aber anders als erwartet, zu bestätigen. Es führt in eine vieldeutige Sprachwelt ein ... und ist vor allem eine Einladung zum Dialog.
Natascha Freundel, rbb Kulturradio
Solche Passagen, wie sie Kapitelman gelingen, kann kaum ein Gegenwartsautor in dieser heiteren Anmut und Zärtlichkeit unserer Sprache entlocken. ... Man begleitet diesen Helden und lässt sich verzaubern von einem schier unverwüstlich wirkenden Glauben an Menschlichkeit.
Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur
Kapitelman erzählt voller Witz, Wärme und Esprit. ... Dmitrij Kapitelman schreibt witzig wie Saša Stanišic, zärtlich-sentimental wie Joseph Roth und ethnografisch genau wie Emilia Smechowski.
Marc Reichwein, Die Welt
Lehrreich, vor allem aber mit einem wunderbaren Humor beschrieben. Das macht stilistisch Freude, ist wortgewandt und gedankentief.
Matthias Schmidt, MDR Kultur
Es geht Kapitelman stark ums Sprachliche. Nicht nur, dass er sächsischen Zungenschlag gut schriftlich zu imitieren weiß, er liefert in seinem Buch auch eine Sprachphänomenologie des Postsozialismus. Und das nicht in platt denunziatorischer Weise, sondern satirisch zugespitzt vor allem über seine Eigenschaft als Doppelsprachler: ... So dient "Eine Formalie in Kiew" auf höchst intelligente Weise der Völkerverständigung – im buchstäblichen Sinne. Obwohl das Buch voller Klischees steckt, deren Richtigkeit es aber lustvoll zu belegen versteht.
Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Kapitelman stößt eine Lachluke auf, durch die Licht in die düsteren Debatten unserer Zeit dringt. ... Erhat ein zärtliches Buch geschrieben: zärtlich seiner alten Heimat gegenüber und seiner neuen, seinem Vaterland und seiner Muttersprache, seinem Papa und seiner Mama. Ein Buch mit zärtlichem Humor vor allem, jeder Witz eine Liebkosung. Eine große Eltern-Sohn-Liebesgeschichte, ein Plädoyer für mehr Herz und weniger Formalien.
Tobias Becker, Spiegel Online
Ein wunderbar tragisch-komisches Buch über die Auswirkungen von Migration.
Mareike Ilsemann, WDR5
Dmitrij Kapitelman erzählt seelenvoll und produziert doch in keinem Moment Kitsch. Sein Roman ist eine ‚schmerzsozialisierte‘, dabei unverhohlen zärtliche Liebeserklärung an ein Elternpaar, dem es nicht gegeben war, in Deutschland heimisch zu werden. Dass Nationalitäten etwas Gleichgültiges sind und nicht wert, Bindungen zu ruinieren, ist das Resümee der meisterhaft unbeschwert erzählten und doch so traurigen Geschichte.
Sigrid Brinkmann, Deutschlandfunk Kultur
Eckdaten
Dmitrij Kapitelman: Eine Formalie in Kiew. Berlin; Hanser Verlag 2021. – ISBN 9783446269378
Quelle : Hanser Literaturverlage

Nadine Schneider
Drei Kilometer
Roman
Rumänien 1989: Die Hitze ist drückend, das Getreide steht hoch, sonst würde man bis zur Grenze sehen können. Der Gedanke an Flucht liegt verlockend und quälend nahe, noch weiß niemand, was kommt und was in ein paar Monaten Geschichte sein wird. In einem Dorf im Banat, weit weg von Bukarest, dem Machtzentrum des Ceaușescu-Regimes, erlebt Anna einen Spätsommer von dramatischer und doch stiller Intensität. Sie ist hin- und hergerissen, nicht zuletzt zwischen Hans, ihrem Geliebten und Misch, dem gemeinsamen Freund. Bei wem will sie bleiben? Mit wem will sie gehen? Und ist Hans tatsächlich ein Spitzel, wie Misch vermutet? Mit diesen Fragen bewegt sich Anna plötzlich gefährlich nahe an der Grenze zwischen Treue und Verrat.
Atmosphärisch dicht und schnörkellos erzählt Nadine Schneider von den persönlichen Verstrickungen in einer Zeit vor dem politischen Umsturz. Und davon, was es braucht, um zu bleiben – oder was es bedeutet, sein Land zu verlassen, für sich und die, die man zurücklässt.
Pressestimmen
Bei diesem Debüt ist das große Weltenbeben oft nicht mehr als ein Hintergrundrauschen, vor dem sich dennoch existenzielle Konflikte abspielen und Liebe und Loyalität, Zugehörigkeit und Identität oder einfach nur das Ende der Jugend mit einer souveränen Lässigkeit geschildert werden. Nadine Schneiders Roman ist wie ein Lied, das man nicht oft genug hören kann. Und daher will ich für die Zukunft nicht ausschließen, 'Drei Kilometer' noch ein viertes, fünftes oder sechstes Mal zu lesen.
Jan Brandt in seiner Laudatio zum Fuldaer Förderpreis
Noch ist die Zeit für den Aufstand nicht gekommen, doch die Risse sind unübersehbar für das Auge der sensiblen Erzählerin. Wie die Hunde im Roman hat sie ein außerordentliches Gespür für die zwischenmenschlichen Beziehungen, für die Zeichen eines kommenden Umsturzes. … Ein Roman, der weniger Schockwellen auslöst als vielmehr ein Gefühl der Unausweichlichkeit.
Elmar Schenkel, FAZ
Das Bestechende an "Drei Kilometer" ist der Umstand, dass seine Autorin nichts versucht, was sie nicht auch beherrscht. Das ambitionierte Metapherngedröhne, das so manches hoch gelobte deutschsprachige Debüt in diesem Jahr charakterisierte, fehlt bei Nadine Schneider ebenso wie staatstragende politische Eindeutigkeit. Schneiders Sprache ist durchsetzt und grundiert von poetisch aufgeladenen Beobachtungen und Beschreibungen, doch bleibt der Blick der Erzählerin stets auf die engen Verhältnisse fokussiert. Es zählt das, was gerade ist.
Christoph Schröder, Die Zeit
Ein unsentimentaler Ton, in den gerade so viel verhaltenes Gefühl gelegt wird, dass die erzählerische Distanz nie aufbricht. […] Nadine Schneider versteht es, mit Nuancen umzugehen, und bei der Lektüre vergisst man, dass es sich um ein Debüt handelt – so dicht und klar und souverän ist diese Prosa.
Gerhard Zeilinger, Der Standard
Sehr gelungen.
Gundula Ludwig, NZZ am Sonntag
Die in Berlin lebende Autorin hat ein schmales, aber beeindruckendes Romandebüt vorgelegt, das gerade aufgrund der sprachlichen Lakonie und der Zurück-genommenheit der Figuren atmosphärisch eine Situation auferstehen lässt, die fernab und im Wirbel der deutschen Wende untergegangen ist.
Ulrike Baureithel, Freitag
Mit diesem Roman ist Nadine Schneider ein fesselndes Sittengemälde des rumäniendeutschen Dorfes in der Endzeit des Sozialismus gelungen. Die Zerrissenheit der Helden zwischen Bleiben und Gehen bestimmt ihr Leben im Provisorium. Trotz gewissem Pathos kommt das schmale Bändchen mit einer gewinnenden Leichtigkeit daher […] ein gelungenes Debüt.
Edith Ottschofski, Deutschlandfunk
Anhand von Gesprächsthemen der Figuren oder Details aus dem Alltag […] wird die Geschichte historisch und kulturell eingebettet, ohne dass das Lokalkolorit aufdringlich würde […] Mit genauem Blick auf einen Augenblick der Weltgeschichte und ihrer unaufgeregten Erzählstimme gelingt der Autorin ein literarisches Zeitdokument, […] eine glaubhafte Geschichte über die Verflechtung persönlicher und politischer Umbrüche.
Veronika Zwing, Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien
Dieser Roman sticht aus der literarischen Masse hervor, weil er auf laute Töne sowie epische Breite verzichtet – und dennoch einiges zu erzählen hat. […] Leise und mit präziser Bildsprache erzählt Nadine Schneider von dramatischen Zeiten. Und nicht zuletzt zeigt sie uns, dass gute Literatur auch berühren darf.
Begründung Shortlist "Das Debüt" 2020
Eckdaten
Nadine Schneider: Drei Kilometer. Roman. Salzburg: Verlag Jung und Jung, 2019. – 160 Seiten. - ISBN 978-3-99027-236-7
Quelle : Jung und Jung
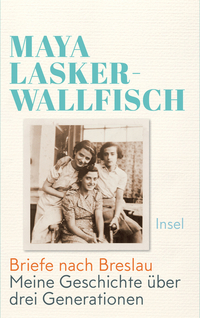
Maya Lasker-Wallfisch
Briefe nach Breslau
Meine Geschichte über drei Generationen
Dort, wo Maya aufwächst, herrscht Schweigen. Die deutsche Vergangenheit, der Holocaust, den die Mutter als Cellistin im Orchester von Auschwitz überlebt – davon wird nicht gesprochen. Dennoch entkommt Maya den Verwundungen der Eltern nicht, ein stabiles Leben scheint unmöglich. Sie treibt durch das London der Siebziger. Zu lange Nächte, Drogen, Schulden, die falschen Typen, eine Flucht nach Jamaika, bei der sie fast stirbt ... Um zu überleben, das ist Maya schlagartig klar, muss sie das Schweigen überwinden. Sie beginnt zu schreiben: Briefe nach Breslau an die von den Nazis ermordeten Großeltern. Stück für Stück setzen ihre Worte eine Familie wieder zusammen, erzählen die Geschichte dreier Generationen im Spiegel der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Dieses Buch ist der Versuch einer Rettung. Maya Lasker-Wallfisch schreibt darin an gegen die Sprachlosigkeit, mutig und gefühlvoll. Sie macht erfahrbar, wie ein transgenerationales Trauma das eigene Leben bestimmt, wie die eigene Geschichte immer abhängt, von dem, was zuvor geschehen ist.
Pressestimmen
Maya Lasker-Wallfisch schreibt mit ihren Briefen nach Breslau eine ergreifende Familiengeschichte – und eine moderne Theorie der Erinnerung.
Manuel Brug, DIE WELT
Mayas mutiges Buch hat das Verständnis für transgenerationelle Übertragungen, den Blick auf mehrere Generationen in historischen Kontexten, stark bereichert. Es erinnert an die gefährlichen psychologischen und politischen Hinterlassenschaften der Nazi-Diktatur und beweist, dass der destruktive Bann der Vergangenheit gebrochen werden kann.
Alexandra Senfft, Der Freitag
... ein eindrucksvolles Buch.
Marta Kijowska, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Berührende Erzählung über das nachwirkende Trauma, die Schoah überlebt zu haben.
Focus
Sie schildert unumwunden die brüske Art ihrer Mutter und klagt dennoch nicht an. Es ist kein Buch der Wut, der Abrechnung, des Zorns, sondern eine Erzählung der Verzweiflung, der nachgetragenen Trauer, der Zärtlichkeit. Erst durch das Schreiben, sagt die 62-jährige Maya Lasker-Wallfisch, wisse sie, wer sie sei, erst jetzt könne sie sich sehen und werde gesehen.
Gabriele von Arnim, Deutschlandfunk Kultur
Familien‐Traumata vererben sich überall, auch an die Kriegskinder und Enkel in Deutschland und anderswo. Daher ist es für jeden Menschen, den die Entwicklung der kriegstraumatisierten Seelen interessiert, ein unbedingt empfehlenswertes Werk.
Maria Ossowski, rbb
Ihre klugen und nicht belehrenden Briefe nach Breslau verdienen viele Leser, die neue Eindrücke und manche Erklärungen über den Holocaust und seine Opfer gewinnen mögen und darüber hinaus eine einzigartige Familiengeschichte erzählt bekommen.
Hans Begerow, Nordwest-Zeitung
Ein hochinteressantes und tief berührendes Buch.
Münchner Merkur
Ein wichtiges Buch, das auf eindringliche Weise deutlich macht, wie sich der Holocaust nicht nur auf die Überlebenden, sondern auch auf die zweite Generation ausgewirkt hat, auf die Kinder der Überlebenden, die nichts über die Familiengeschichte wussten, da ihre Eltern sie vor dem Wissen um das Grauen der Shoah schützen wollten und daher lange Zeit geschwiegen haben.
Doris Hermanns, aviva-berlin
Briefe nach Breslau ist ein Buch, das berührt. Maya Lasker-Wallfisch schreibt einfühlsam und schafft es, ein sensibles Thema lebendig zu porträtieren.
Peter Sawicki, Deutschlandfunk
Eckdaten
Maya Lasker-Wallfisch: Briefe nach Breslau. Meine Geschichte über drei Generationen. Berlin: Insel Verlag, 2020. 254 Seiten ISBN 9783458178477
Quelle : Suhrkamp
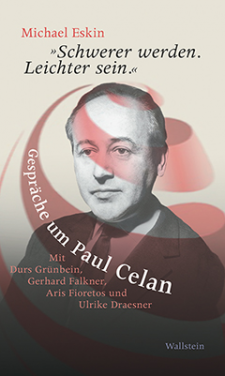
Michael Eskin
"Schwerer werden. Leichter sein."
Gespräche um Paul Celan. Mit Durs Grünbein, Gerhard Falkner, Aris Fioretos und Ulrike Draesner
Aus dem Inhalt:
Das vorliegende Buch ist Frucht und Zeugnis meines Versuchs im Kreise Anderer mit und um Celan zu sprechen. Die Gespräche wurden schriftlich über einen Zeitraum von mehreren Monaten geführt. Alle Gesprächspartner sind Celan tief verbunden und sprechen ihn in den verschiedensten Registern und Tönen auf je eigene, besondere Weise weiter. (…) Mich zumal hat jedes Gespräch nicht nur Paul Celan neu sehen, hören und sprechen gelehrt… Möge es Ihnen ebenso ergehen.
Auf den Namen Celan stieß ich zum erste Mal bei dem Philosophen Adorno. (…) Als ich dann die „Todesfuge“ las, war ich überrascht, wie einfach er sich ausdrückte. Ich hatte, weiß Gott was erwartet, dunkle hermetische Texte, von enormem Schwierigkeitsgrad – und dann das. (…) was ich damals erfasste, war, dass es um eine Scham ging, um eine große Scham. Die Scham dessen, der er sich dafür schämte, dass offenbar kaum einer unter den Menschen seiner Zeit sich schämte. (…) Das Thema seiner Scham ist mir seither nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Wieso schämte sich dieser feine Mensch so sehr für seine Mitmenschen, dass er immer dünnhäutiger wurde, immer misstrauischer auch, ja geradezu paranoid, bis er es schließlich nicht mehr aushielt und nur noch verschwinden wollte? Man konnte sein Werk aus mehreren Perspektiven lesen. Als eine Anklage der deutschen Judenmorde und der Verdrängung dieses Verbrechens nach dem Krieg. Als einen Versuch, vor dem schrecklichen Realitätsprinzip Geschichte in die Dichtung abzutauchen (…).
Sein ganzes Werk ist ein Momento mori - ein Zuruf an die Lebenden im Namen der Ermordeten und Verstoßenen. Geschichtsschreibung aus der Sicht der Verlierer, wie Walter Benjamin sie gefordert hat.
Ich war ein früher Leser Celans. Ich stieß auf ihn bereits Ende der Sechzigerjahre, (…) Der Eindruck dieser Gedichte war damals so stark, dass mir augenblicklich bewusstwurde, wie groß die Gefahr war, ihrer Ausdruckswelt zu nahe zu kommen, wo ich doch selbst gerade dabei war, eine eigene poetische Sprache zu entwickeln.
(…) die Unbedingtheit Celans in seiner Dichtung (wie in seinem Leben) ist evident: Da gibt es nirgends Kompromiss, keine Kniefälle vor dem Leser, keine Retouchen, keine Verhandlungsangebote. Celan bleibt immer im innersten Bezirk der Gefahrenzone von Sprache, bedingt durch die Erfahrung von Terror und Schmerz. Zum Thema Unbedingtheit schreibt Jaspers: "Nur wer sich in der Grenzsituation bedingungslos zur eigenen Existenz bekennt, erfährt die Unbedingtheit dieser Existenz und die Freiheit, die daraus entspringt und zum Selbstsein führt."
(…) wer vermöchte, von uns heutigen Dichtern, ein Urteil abzugeben über Paul Celan, der uns doch alle überragt, an Form und Imagination, an Schicksal und an Bedeutung, sowohl als Dichter als auch an Mensch.
Ich weiß von niemandem in der Nachkriegslyrik, der sich besser in der Philosophie und der Ästhetik, in der Sprach- und Literaturtheorie auskannte. Das macht es aber schwierig, Celan unvoreingenommen zu lesen. Auch gedanklich ist sein Dichten auf Augenhöhe mit den Texten der Denker.
Nimm den Farbenkreisel, den wir alle aus unserer Kindheit kennen. (…) Wenn der Kreisel sich schnell genug dreht, erscheinen die unterschiedlichen Farben fürs menschliche Auge als eine einzige, aus vielen Segmenten zusammengesetzte Mischfarbe – eben als Grau. Wenn die Rotationsgeschwindigkeit wieder sinkt, treten die einzelnen Töne und Schattierungen, die Nuancen und Übergänge, erneut hervor. Ich nehme Celans „graue Sprache“ gerne so wahr: als einen versteckten Regenbogen, der vom Leser Geduld und Feingefühl fordert. Wie sagte er einmal als man seiner Dichtung wieder mal Unverständnis vorwarf? – Lesen Sie! Immerzu lesen, das Verständnis kommt dann von selbst! – Celans sprach-spektrale Gebilde wollen irisieren.
(…), weil Buchstaben sowie einzelne Laute mich seit jeher anzogen. Ich bin Linkshänderin und lese oder schreibe gerne gleichermaßen von links oder rechts.So begann ich Celan zu lesen – und mochte was ich fand, mochte die Würfelform der Worte. Diese Dichte, jedes ein Planet, mit Schwerkraft – etwas was Licht biegt. Licht blitzte dort, leuchtete mir ein. War es doch verbunden mit nur gezeichneten, durch Licht kopierten Häusern, mit Geräuschen und ihren Veränderungen, mit dem Tragen von etwas, das nicht verloren gehen durfte, verbunden mit etwas das Heimat hieß, aber immer ein anderer Ort sein musste als jener, an dem man sich befand. Mich berührte ebenfalls, dass ich nicht "alles" verstand, aber immer nachdenken/nachhören konnte.
In der Begegnung mit Celans Sprach(en)welten verstand ich, dass es Möglichkeiten gibt, in das, was mich umgab (der Sprachgebrauch, die Normalität), Löcher zu schneiden. Festgefügtes in Bewegung zu setzten (Türme). Dafür den Wort-Schatz herzunehmen (Etymologie, Fachsprache). Und das eben dies, das Umdefinieren der Zeichen, das Neu-Beatmen, Poesie heißt
Pressestimmen
Eskins Gespräche (…) zeigen in ihrer sensiblen wie gelehrten Verspieltheit (…), wie lebendig Celan ist und wie produktiv der Umgang mit seinem Werk.
Jochen Hieber, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Eckdaten
Michael Eskin: „Schwerer werden. Leichter sein.“ Gespräche um Paul Celan. Mit Durs Grünbein, Gerhard Falkner, Aris Fioretos und Ulrike Draesner. - Göttingen: Wallstein Verlag, 2020.- 176 Seiten. - ISBN 9783835336315
Quelle : Wallstein Verlag
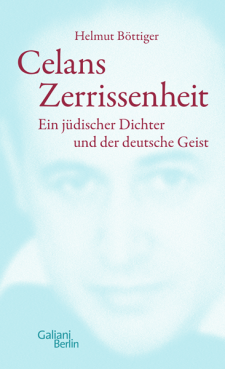
Helmut Böttiger
Celans Zerrissenheit
Ein jüdischer Dichter und der deutsche Geist
Helmut Böttiger wirft einen ganz neuen Blick auf den Dichter und räumt mit vielen Mythen und Vorurteilen rund um Celan auf. Von den Rechten, die ihn faszinierten, abgelehnt; von Linken bewundert, die ihn missverstanden. An kaum einem deutschsprachigen Autor zeigen sich die Verwerfungen der Nachkriegszeit deutlicher als an Celan. Während mit Heidegger, Jünger u.a., die konservativen Vertreter des Deutschen Geists Celan ablehnten, waren dessen Verehrer Böll, Grass, Enzensberger dem Dichter fremd. Auf Knüppelpfaden und Holzwegen war er unterwegs, der Ausnahmedichter Paul Celan. Bis heute ist das Bild, das man sich von ihm macht, geprägt von Missverständnissen, falschen Vorstellungen und heroischen Romantisierungen. Zum “Schmerzensmann” und in die Rolle des “jüdischen Opfers” stilisiert; wurde der Dichter auf vertrackte Weise ein “ideales Vehikel für die allgemeine Verdrängung”, so Helmut Böttiger. Seine Todesfuge avancierte zum Schulgedicht, der Rest des Werks trat dagegen zurück. Dass Celans Suche nach einer neuen dichterischen Sprache ihn paradoxerweise (vergeblich) die Nähe von Ernst Jünger, des von Celan “Denk-Herrn” genannten Martin Heidegger oder sogar Figuren wie Rolf Schroers suchen ließ, während er mit der Sprachhaltung seiner Förderer Böll und Grass wenig anfangen konnte, wurde dabei oft übersehen oder passte nicht ins Bild. Helmut Böttiger zeichnet Leben und Werk Celans auf dem Hintergrund des literarischen Betriebs seiner Zeit. Heraus kommt dabei ein ganz neuer Blick auf Celan.
Pressestimmen
Ein Essay, der auf 170 Seiten den verqueren Links-rechts-Magnetismus des Dichters zwischen den politisch-ästhetischen Nachkriegsfronten elegant und pointiert zusammenfasst. Man kann ihn mit Gewinn als Einführung in die Welt von Paul Celan überhaupt lesen.
Gregor Dotzauer, Der Tagesspiegel
Mitreißend geschrieben und im Detail von großer Plausibilität.
Ein tiefschürfender Essay, in dem Böttiger sich der vielen Ambivalenzen des Dichters widmet.
Thomas Plaul, Saarländischer Rundunk
Böttiger zeichnet Celan selbst als vielgestaltigen Charakter [...] Celan wird [...] weder zum Helden verklärt, noch auf eine Opferrolle reduziert. Sehr erhellend.
Jan Kuhlbrodt, Signaturen Magazin
Mit großer Eindringlichkeit zeichnet Helmut Böttiger den Spagat nach, den Celan als Holocaustüberlebender beim Verkehr mit Intellektuellen vollzog, die ungewollt oder gewollt in die Mühlen des Hitler-Regimes geraten waren. Er porträtiert ihn als tief verunsicherten Mann, der danach strebte, Brücken über ideologische Gräben zu schlagen. Dass Celan daran scheiterte, beweist sein Suizid.
Ulf Heise, MDR Kultur
Ein brillanter Essay über Deutschland und seine Dichter, auch eine beunruhigende Studie über Projektion als alltäglichen Betriebsunfall in der Literaturgeschichte.
Elke Schmitter, Der Spiegel
Helmut Böttiger, der schon in der Vergangenheit einige wegweisende Bücher über Celan geschrieben hat, gelingt es, mit Witz und Verve, mit Präzision und der Kunst der Verdichtung alle Fragen zu beantworten. (...) Glänzend arbeitet er die Widersprüche dieses Zerrissenen heraus.
Alexander Solloch, NDRkultur Neue Bücher
Aus dem Traum von einer gemeinsamen deutschen Überlieferung, das zeigt Böttiger sehr überzeugend, nährt sich Celans Missverständnis, im Kreis des über den Holocaust beharrlich schweigenden Schwarzwälder Kulturkonservatismus besser aufgehoben zu sein als an der Seite der kritischen deutschen Autoren, die der Dichter in völliger Verkehrung aller Proportionen für seine eigentlichen Feinde hält.
Iris Radisch, Die Zeit
Eckdaten
Helmut Böttiger: Celans Zerrissenheit. Ein jüdischer Dichter und der deutsche Geist. - Berlin: Galiani, 2020. - 199 Seiten. - ISBN 9783869712123
Quelle : Verlag Galiani Berlin
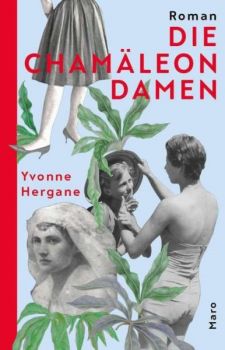
Yvonne Hergane
Die Chamäleondamen
Roman
Pressestimmen
Das Buch besticht durch großen Sprachzauber, viel Herz und eine mitreißende Geschichte. Unbedingt lesen!
Brigitte Wallinger
[Der Roman] bietet mit seiner mehrfach gebrochenen und letztlich zerrissenen migrantisch / postmigrantischen Perspektive ein fast durchgehend gestreutes Gefühl von Unbehaustheit. Nur durch Zusammenhalt, familiär und sozial, kann überhaupt eine Basis des Entgegentretens formuliert werden.
Jonis Hartmann auf fixpoetry
In Zeiten der Pandemie kommt Literatur eine erweiterte Bedeutung zu. Wem ist dieses Buch nahezulegen? Der ›Beipackzettel‹ des Rezensenten zu diesem Buch: Leser, die Tag täglich über ihr Schicksal seufzen, ist dieses Buch dringend empfohlen. Damen sollten es nicht zu hastig lesen – wegen möglichem Schluckauf beim Grinsen. Und Herren sollen sich nicht so anstellen – das Buch tut ihnen bestimmt auch gut. Die knappen Kapitel eignen sich sogar für die Lektüre zwischendurch, beispielsweise in der U-Bahn.
Ortwin-Rainer Bonfert auf dem Blog Sätze und Schätze
Eckdaten
Yvonne Hergane: Die Chamäleondamen: Roman. - Augsburg, MaroVerlag, 2020. - 240 Seiten. - ISBN 978-3-87512-493-4
Quelle : MaroVerlag