Die Gabe des Gedankenlesens erbt der kleine Anton vom Großvater, dem Gänsehirten − und er rettet damit das Leben seiner Mutter: Diese Erinnerung ist der Beginn der Geschichte des heute fast 80-jährigen Anton Busch. Geboren 1939 im pommerschen Schönow − als Kind einer Bauernfamilie aus dem Oldenburger Münsterland − erzählt er von seiner entbehrungsreichen Kindheit, von Krieg und Flucht. Er wird erwachsen in den Wirtschaftswunderjahren einer jungen BRD, arbeitet, heiratet, lernt und liebt. Sein hohes Alter ist geprägt von zwei Erkenntnissen: Jedes Leben ist einzigartig. Und kein Mensch lebt nur ein Leben. Manchmal sind es sogar ganz viele ...
Buchtipp des Monats - Belletristik
Jahresarchiv
- Belletristik
- Sachbuch
2020
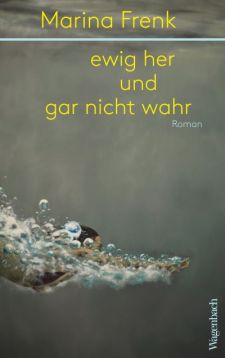
Marina Frenk
ewig her und gar nicht wahr
Roman
Kann man sich totstellen, um der sicheren Erschießung zu entkommen? Einen Fluch unschädlich machen, indem man die Tür verriegelt? Den Abschied vergessen und Gefühle auf Leinwand bannen? Kira erzählt ihre Familiengeschichte. Eine Geschichte von Aufbrüchen und Verwandlungen, von Krokodilen und Papierdrachen. Die junge Künstlerin Kira lebt mit Marc und dem gemeinsamen Sohn Karl in Berlin. Sie gibt Malkurse für Kinder, hat lange nicht ausgestellt, lange nichts gemalt – und zweifelt. Ihre Beziehung zu Marc ist sprach- und berührungslos. Ihre leicht verrückte Freundin Nele fragt manches, versteht viel und lacht gern, während Kira glaubt, in die Zukunft zu sehen und die Vergangenheit zu erfinden. In den neunziger Jahren ist sie mit ihren Eltern aus Moldawien nach Deutschland gezogen, irgendwo angekommen ist aber keiner in ihrer russisch-jüdischen Familie. Kira betrachtet nicht nur das eigene Leben, mitunter zynisch und distanziert, sondern auch das ihrer Vorfahren, die sie teilweise nur von Fotos kennt. Sie reist nach New York, Israel und Moldawien, versucht, die Geschichten zu begreifen und in ihren großformatigen Bildern zu verarbeiten.
Marina Frenk findet eine frische, bilderreiche und sehr körperliche Sprache. Ihr eindrückliches, raffiniert gebautes Debüt ist ein Buch über Familie und Herkunft, über Eltern- und Kindschaft. Es ist ein heutiger Künstlerinnenroman und vor allem auch der Roman einer Liebe.
Pressestimmen
Ein hinreißender Debütroman voller Liebe zu den Menschen, mit feinem Gespür für die Verwerfungen der Geschichte. Die aus Moldawien stammende Marina Frenk hat ein humorvolles und poetisches Buch geschrieben: über Herkunft, Liebe und das schmerzhafte Ankommen bei sich selbst.
Carsten Hueck, SWR2
Klar und unverschnörkelt erzählt sie eine nachdenkliche und psychologisch ausgeklügelte Geschichte, die zugleich von gieriger Lebensenergie zeugt. „ewig her und gar nicht wahr“ ist die Geschichte einer Migration, aber eben doch kein Migrationsroman (...) Dieser Debütroman ist erstaunlich, und er ist unbedingt lesenswert. Denn Marina Frenk hat eine Geschichte zu erzählen und die literarischenMittel, sie aufzuschreiben. Ganz ohne Nostalgie und Wehmut liefert sie einen intimenBericht darüber, wie ein Mensch trotz aller Zweifel und Konflikte einen Weg findet, die Bilder der Vergangenheit mit der gelebten Gegenwart zu verbinden.
Stilistisch bewundernswert schreibt sich die in Moldau geborene Autorin (Schauspielerin und Musikerin) Marina Frenk anhand ihrer eigenen Migrationsgeschichte an die alle Zugehörigkeiten kalt zermalmende Gewalt der jüngeren, fatal von Systemen, Nationalitäten und Rassen faszinierten Geschichte heran. Und das geschieht so spielerisch und leichtfüßig, dass wir es zunächst kaum bemerken, weil wir gebannt die höchst gegenwärtige Erzählung über die junge Berliner Malerin Kira verfolgen.
Oliver Jungen, FAZ
... ein mehrdimensionales Werk, dessen zentrale Themen sowohl Entwurzelung als auch Familie und die in der Familie freiwillig oder unfreiwillig geteilte Aufgabe der Erinnerung und Vergegenwärtigung der eigenen Herkunft sind. Herkunft kann dabei zwar an einen Ort gebunden sein, aber: „Das Wesentliche liegt irgendwo anders als in der Geographie“. Wie etwa Kiras Gespräche mit älteren Verwandten nahelegen, kann Herkunft vor allem auch bedeuten, eine geteilte Erinnerungsaufgabe anzunehmen.
Luisa Banki, Literaturkritik.de
Mit den Sprüngen zwischen Zeiten, Orten, unmittelbaren Ereignissen und Fantasien entsteht der Kritikerin zufolge eine außergewöhnliche Erzählung, die mal bitter und dann plötzlich "zärtlich, flink und komisch" sein kann. Ein starkes Debüt!
Behrendt, Tageszeitung
Marina Frenk schreibt dicht und plastisch, mit ungewöhnlichen Sprachbildern, dabei so, als würde sie ein detailreiches Gemälde verfertigen, passend zum Beruf ihrer Erzählerfigur. Es setzt sich zum Beispiel zusammen aus der Flucht von Bessarabien durch die Ukraine und einem traumatischen Kriegserlebnis 1941, aus peinlichen Begegnungen mit den lieben Verwandten in Chisinau 1948. (...)Dieser durch die Zeiten und über die Landstriche gewebte Roman hält durch seine Gedankenfülle in Atem.
Cornelia Geißler, Berliner Zeitung
Eckdaten
Marina Frenk: ewig her und gar nicht wahr. Berlin: Wagenbach Quartbuch, 2020. 240 Seiten. ISBN 978-3-8031-3319-9
Quelle : Verlag Klaus Wagenbach
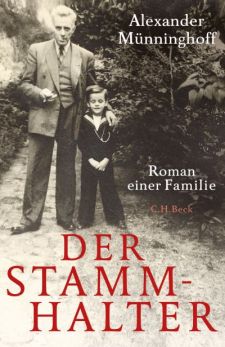
Alexander Münninghoff
Der Stammhalter
Roman einer Familie
Der findige Großvater mit seiner Firma, ein lebenshungriger Sohn und ein Enkel, der Stammhalter, der entführt werden muss: Zwischen diesen Generationen entspinnt sich die wahre Geschichte vom Niedergang einer Familie im 20. Jahrhundert, nicht durch den Krieg, der gut für die Geschäfte ist, sondern weil jeder für den anderen «nur das Beste» will. Alexander Münninghoff hat aus den vielschichtigen Beziehungen einer Familie, aus der versunkenen Welt zwischen Riga und Den Haag, einen zauberhaften, bewegenden Roman geschaffen.
Der niederländische Kaufmann Joannes Münninghoff führt im baltischen Riga an der Seite seiner schönen russischen Gattin Erica ein mondänes Leben. Allmählich bahnt sich ein Drama an, das mit dem Krieg seinen Lauf nimmt: Sein Sohn Frans geht zur Waffen-SS, der alte Herr setzt sich nach Den Haag ab. Weil Frans nicht zum Erben taugt, gerät der Enkel als Stammhalter ins Visier, doch seine Mutter flieht mit ihm nach Deutschland …
Alexander Münninghoff hat mit dieser wahren Geschichte eine große Familiensaga geschrieben. Mit wunderbarer Leichtigkeit lässt er seine Figuren lebendig werden, beschreibt mit wenigen Strichen unvergessliche Szenen, immer so, dass ein leises Donnergrollen im Hintergrund hörbar ist. Es kündigt nicht die eine große Katastrophe an, sondern die fast unmerkliche Auflösung von Beziehungen, Hoffnungen und Leidenschaften.
Pressestimmen
Man muss unweigerlich an Thomas Manns Buddenbrooks denken. Die erschütterndsten Dramen werden in einem distanzierten Ton erzählt, einen Hauch amüsiert gar, (…) aber das ist sicher die beste Art, einer ergreifenden Familienvergangenheit gerecht zu werden, die reicher ist als jede romanhafte Fiktion.
Le Monde
Eine Geschichte, die schillernder und spannender nicht sein könnte und von Münninghoff trotzdem ganz unaufgeregt und schonungslos erzählt wird.
Roana Brogsitter, Bayern 5
Alexander Münninghoff hat aus den vielschichtigen Beziehungen einer Familie, aus der versunkenen Welt zwischen Riga und Den Haag, einen zauberhaften, bewegenden Roman geschaffen.
Passauer Neue Presse
Hinreißend erzählte Familiengeschichte (…) Lange Zeit nicht mehr so etwas Gutes gelesen.
Dresdner Morgenpost
Eine unglaubliche Geschichte
Nicolas Tribes, WDR 3
Eine solche Familiensaga kann sich ein Autor fiktiver Romane kaum ausdenken. Das muss man erlebt haben.
Saale Zeitung
Eine romanhafte, ganz außergewöhnliche Lebensgeschichte (…). Ein wahres Familiendrama vor den Tragödien europäischer Geschichte.
Südwest Presse
Ein überwältigendes Buch ... Ich habe es atemlos gelesen.
Anna Enquist
Eckdaten
Münnighoff, Alexander: Der Stammhalter. Roman einer Familie.- München: C.H.Beck, 2018.- 333 Seiten. ISBN 9783406727320
Quelle : C.H. Beck Verlag
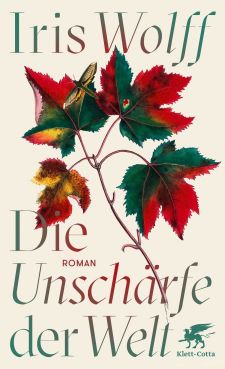
Iris Wolff
Die Unschärfe der Welt
Roman
Iris Wolff erzählt die bewegte Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren Bande so eng geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen hinweg nicht zerreißen. Ein Roman über Menschen aus vier Generationen, der auf berückend poetische Weise Verlust und Neuanfang miteinander in Beziehung setzt.
Hätten Florentine und Hannes den beiden jungen Reisenden auch dann ihre Tür geöffnet, wenn sie geahnt hätten, welche Rolle der Besuch aus der DDR im Leben der Banater Familie noch spielen wird? Hätte Samuel seinem besten Freund Oz auch dann rückhaltlos beigestanden, wenn er das Ausmaß seiner Entscheidung überblickt hätte? In »Die Unschärfe der Welt« verbinden sich die Lebenswege von sieben Personen, sieben Wahlverwandten, die sich trotz Schicksalsschlägen und räumlichen Distanzen unaufhörlich aufeinander zubewegen. So entsteht vor dem Hintergrund des zusammenbrechenden Ostblocks und der wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts ein großer Roman über Freundschaft und das, was wir bereit sind, für das Glück eines anderen aufzugeben. Kunstvoll und höchst präzise lotet Iris Wolff die Möglichkeiten und Grenzen von Sprache und Erinnerung aus – und von jenen Bildern, die sich andere von uns machen.
»Es gab Sehnsucht nach etwas, das verloren war, Sehnsucht nach etwas, das sich nicht erfüllt hatte, Sehnsucht danach, etwas zu finden, und manchmal auch danach, etwas zu verlieren.«
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2020, den Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Belletristik 2020 sowie den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2020
Pressestimmen
So schön hat noch niemand Geschichte zum Schweben gebracht
Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung
Es ist der Klang der Sprache, ein weiches Schwingen oft kurzer Sätze, das sofort für Die Unschärfe der Welt einnimmt. […] Er ist ein Zauberkunststück der Imagination, ohne ins Beliebige des bloß Vorgestellten abzudriften.
Meike Feßmann, Süddeutsche Zeitung, 09.09.2020
Jede der sieben Hauptfiguren wird zur Heldin ihrer eigenen, klug pointierten Episode. Das führt nicht nur gegenläufige Perspektiven zusammen, sondern beschert uns auch mit jedem Kapitel den Zauber eines neuen Anfangs.
Georg Leisten, Südwest Presse, 21.8.2020
Es ist der Ruf des Wassers, seine Freiheit, die die Menschen anlockt, und die Kunst, die alle Figuren bei Iris Wolff zu beherrschen lernen müssen, ist, diesem Lockruf nicht einfach zu folgen, den festen Boden der Herkunft nicht leichtfertig aufzugeben und ins funkelnde Unfassbare zu gehen – natürlich eine Metapher für die Ausreise, aber keine, die als Kritik an Menschen zu verstehen wäre, die dem Untragbaren nicht länger standhalten wollen, sondern eine, die jene seelische Last deutlich macht, die auch nach der Befreiung von der Tyrannei nicht abgeschüttelt werden kann.
Andreas Platthaus, FAZ, 27.8.2020
Iris Wolff verfügt über ein unglaublich raffiniertes psychologisches Besteck – ein Instrument mit dem sie ihre Figuren zeichnet. Das ist im Grunde wie Aquarell, aber hinterher hat man wirklich das Gefühl: Wow, das ist wirklich ein großes Panorama, das hier entworfen wurde«. Eine Autorin mit einem traumsicheren Sprachgefühl
Dennis Scheck, WDR2, 30.08.2020
Ihre große Qualität ist vielleicht das, was Peter Handke einmal bezogen auf den Autor Herrmann Lenz poetischen Geschichtsunterricht genannt hat. Das heißt sie hat eine Sprache gefunden, […] um Figuren aufblitzen zu lassen in dem was sie durchmachen müssen. […] Iris Wolff hat wieder einen großen Roman geschrieben.
Rainer Moritz, NDR, 01.09.2020
Iris Wolf erhält an den Rändern der politischen Systeme entlang und überschreitet diese. … Die Autorin erzählt anrührend und aufwühlend, weil sie oft den realen Hintergrund im Unscharfen, ihr Personal und dessen Erlebnisse äußerst plastisch erscheinen lässt.
Cornelia Geißler, Berliner Zeitung, 24.08.2020
Es sind … die Fäden, die sich unsichtbar zwischen den Menschen spannen, die das Buch so besonders machen.
Gabriele Weingartner, RHEINPFALZ, 24. 08. 2020
"Die Unschärfe der Welt" ist sicherlich einer der schönsten, mitreißendsten und feinsten Romane dieses Büchersommers, ja gar dieses Jahres.
Roland Freisitzer, Sand am Meer, 24. August 2020
Ein Glücksfall für die deutschsprachige Literatur.
Gérard Otremba, Sounds & Books, 22. August 2020
Iris Wolff schreibt Literatur, die sich Strömungen verweigert. Zeitlos und zauberhaft.
Jan Haag, Litos, 21. August 2020
Die Autorin erzählt anrührend und aufwühlend, weil sie oft den realen Hintergrund im Unscharfen, ihr Personal und dessen Erlebnisse äußerst plastisch erscheinen lässt. ... Es gibt unerwartete Wiederbegegnungen, manche zu schön, um wahr zu sein, aber der Roman hat seine eigene Wahrheit. Wie gut, dass er zu den Nominierten für den Deutschen Buchpreis gehört.
Cornelia Geißler, Berliner Zeitung, 24. August 2020
Iris Wolff hat Sprachvermögen, das aus den Quartieren ihrer Bildung sowie aus der deutsch-rumänischen Sprachbürgerschaft ein Buch entwickelt hat, das ihr und auch den Leser eine Heimstatt sein kann. Dies vermag nur Literatur von Rang.
Matthias Buth, Herrmannstädter Zeitung, 14. August 2020
Eckdaten
Wolf, Iris: Die Unschärfe der Welt. Roman. Stuttgart: Klett-Cotta, 2020. - 213 Seiten - ISBN 9783608983265
Quelle : Klett-Cotta
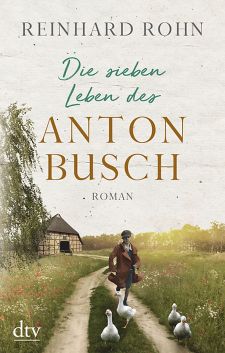
Reinhard Rohn
Die sieben Leben des Anton Busch
Roman
Pressestimmen
Das Ergebnis ist ein lebensnahes, gefühlvolles Buch, das nicht nur die großen Ereignisse beschreibt.
Stefan Keim, WDR 4, Bücher
Reinhard Rohn lässt das alte Pommern und das neue Norddeutschland auf einfühlsame Weise wieder lebendig werden.
Christian von Zittwitz, BuchMarkt
Ein wunderbares, gefühlvolles, lebensnahes Buch.
Gabriele Rojek, Der Evangelische Buchberater
Ein wunderbarer Roman, die perfekte Lektüre für lange Stunden im Haus.
Gabriele Haefs, Publik Forum
Anrührend und fesselnd, atmosphärisch dicht und authentisch - ein Roman, der in vielen Bibliotheken gut eingesetzt werden kann.
ekz.bibliotheksservice GmbH
Eckdaten
Reinhard Rohn: Die sieben Leben des Anton Busch: Roman. - München: dtv, 2019. - Originalausgabe. - 448 Seiten. - ISBN 978-3-423-28202-4
Quelle : dtv
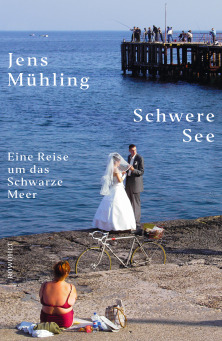
Jens Mühling
Schwere See
Eine Reise um das Schwarze Meer
Die Lektüre von „Schwere See“ ist eine der literarischen Reisen, die im #staycation-Sommer 2020 nicht den realen Ortswechsel ersetzen, aber dennoch eindringlich, lohnend und befreiend sein können.
Aus großer Nähe, relevant, poetisch, humorvoll und eindringlich erzählt Jens Mühling von einem Meer zwischen den Trennlinien Europas, von seinen Ufer- und Wasserbewohnern, seinen Strömungen und Migrationswegen, seiner Vergangenheit und Zukunft – und führt uns vor Augen, dass alle Grenzen letztlich fließende sind.
«Ich habe das Schwarze Meer von allen Seiten gesehen, und von keiner Seite war es schwes schwarz. Es war silbrig, als ich im Frühling die noch menschenleeren Strände der russischen Kaukasusküste entlangfuhr. Es wurde blau, als ich im Mai Georgien erreichte. In der Türkei schien es dem Grün der Teeplantagen und Haselnussfelder an seinen Ufern ähnlicher zu werden, und grün blieb es, bis ich im Spätsommer den Bosporus erreichte. Die ersten Herbststürme färbten es braun, als über der Küste Bulgariens die Vögel südwärts und die Touristen heimwärts zogen. Im rumänischen Donaudelta schien der Himmel so tief über dem Meer zu hängen, dass sein bleierner Ton auf das Wasser abfärbte. Als ich die Ukraine erreichte, schoben die Wellen schmutzgraue Eisschollen über die Strände. Erst auf der Krim hellte die Wintersonne das Meer wieder auf, und hier nahm es den Ton an, den es in meiner Erinnerung immer haben wird: ein trübes, milchiges Grün, wie ein Sud aus Algen und Sonnencreme. »
(Rowohlt Verlag)
«Sechs Länder grenzen ans Schwarze Meer. Karadeniz nennen es die Türken. Marea Neagră sagen die Rumänen, Schawi Sghwa die Georgier. Bei den Bulgaren heißt es Tscherno More, bei den Russen Tschornoje Morje, bei den Ukrainern Tschorne More. Sechseinhalb Länder sind es, wenn man Abchasien mitzählt, eine abtrünnige Provinz Georgiens. Sieben, wenn man Moldawien mitzählt, wo es einst eine Küste gab, bevor das Land landeinwärts wanderte. Siebeneinhalb, wenn man Transnistrien mitzählt, eine abtrünnige Provinz Moldawiens. Siebeneinhalb, wenn die Krim zu Russland gehört, siebeneinhalb, wenn sie zur Ukraine gehört, acht, wenn man die Krim lieber für sich nimmt. Achteinhalb, wenn man das Ruinenreich der alten Griechen mitzählt».
«Schwere See» porträtiert das Schwarze Meer als Lebensraum. Geschrieben in Form einer Reisereportage, die den Leser im Kreis um das eurasische Binnengewässer führt, schlägt das Buch gleichzeitig Haken in die Historie, thematisiert Konflikte unter den Anrainern, setzt sich mit der Umwelt- und Wirtschaftssituation des Gewässers auseinander und trägt Sagen, Legenden und literarische Annäherungen zusammen. Christlich-orthodoxe Russen, Ukrainer, Georgier und Bulgaren treffen im Schwarzmeerraum auf muslimische Türken und Krimtataren, rumänische Katholiken, chassidische Juden und russische Altgläubige. Wirtschaftliche Interessen verbinden und trennen die Schwarzmeeranrainer, politische Differenzen, unterschiedliche Geschichtsbilder und abweichende Zukunftsvisionen prägen ihren Blick auf das Gewässer, an dessen Ufern sie sich begegnen.
(Klappentext)
Pressestimmen
Eine poetische Reisereportage.
Recklinghäuser Zeitung
Mit Jens Mühling zu reisen ist einfach großartig. Der Leser hat oft das Gefühl dabei zu sein, bei dieser acht Monate währenden Tour per Taxi, Anhalter, Bus oder Schiff rund um das Schwarze Meer.
Regine Förster, MDR KULTUR
Mühlings intensive Beobachtungen, sein scharfer Sinn für gute Geschichten machen dieses Reisebuch zu einem großen Gewinn. Denn solche Erlebnisse sind es, die den wahren Reisenden vom Urlauber unterscheiden.
Süddeutsche Zeitung
Mühling hat ein Faible für poetische Pointen, die so treffsicher sind, dass man ihm sogar verzeiht, wenn die eine oder andere ein bisschen zu blumig ausfällt. Letztendlich weben sich alle Einzelgeschichten in ein poetisches Gesamtbild. Das Ergebnis ist ein sehr diverses Porträt der Schwarzmeerbewohner und ihrer verworrenen Geschichten.
Sarah Murrenhoff, dlf kultur
Eckdaten
Jens Mühling: Schwere See – Eine Reise um das Schwarze Meer. – Hamburg: Rowohlt Verlag, 2020.- 314 Seiten. – ISBN 978-3-498-04545-6
Quelle : rowohlt Verlag
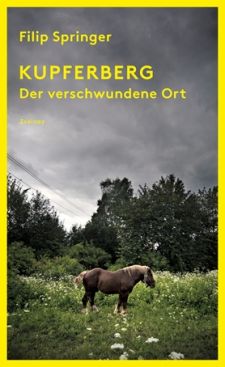
Filip Springer
Kupferberg
Der verschwundene Ort
"Wie kann ein Dorf einfach verschwinden?" - mit archäologischer Präzision ergründet Filip Springer die Geheimnisse der ehemaligen Bergbau-Stadt Kupferberg in Niederschlesien.
1311 wird der Ort in Polen erstmals erwähnt. Heute existiert Kupferberg nicht mehr. Nur eine Flasche Bier und ein Porzellanverschluss sind übrig, als sich Filip Springer mit archäologischer Präzision daranmacht, die Geheimisse der verschwundenen Stadt zu ergründen. Der Bergbau lässt das Dorf in idyllischer Lage wachsen. Keiner der vielen Kriege bis zum Zweiten Weltkrieg kann ihm etwas anhaben. Danach wird aus Kupferberg Miedzianka, eine Stadt, die wiederaufgebaut und zu einem Zentrum des Abbaus von Uran wird. Bis der Untergrund durchlöchert ist und man dort nicht mehr leben kann … Filip Springer zeichnet die Geschichte eines langsamen Untergangs nach. Eine Chronik spannend wie ein Roman.
Pressestimmen
Filip Springer hat Kupferberg/Miedzianka mit den Mitteln der Reportage ausgegraben. Er lässt das im 13. Jahrhundert gegründete Städtchen in grosser Intensität wieder erstehen. Entstanden ist so die genaue, lakonische Geschichte eines Verschwindens.
Cord Aschenbrenner, Neue Zürcher Zeitung, 06.02.20
Filip Springer schildert das Leben in Kupferberg mit großer erzählerischer Präzision und einem feinen Gespür für Symbolik. Ohne Pathos gelingt es ihm, Heimat als einen universellen Wert darzustellen. Fesselnd wie in einem Roman.
Moses Fendel, WDR3, 06.12.19
Kupferberg führt einem wieder vor Augen, was die Reportage als Gattung vermag, verstanden nicht als pseudo-emotionales "Storytelling", sondern als geduldige, informierte Langzeitbeobachtung. (…) Aus Dokumenten und Gesprächen gewinnt Springer eine fesselnde Darstellung der politischen, menschlichen und ökologischen Umstände dieses zweiten Raubbaus.
Christoph Bartmann, Süddeutsche Zeitung, 22.11.19
Kunstvoll montiert Springer aus einer Anekdotenansammlung unterschiedliche Einblicke in das Seelenleben des Ortes. Damit wird sein Buch ganz beiläufig zu einem Brennglas, unter dem die massiven Umbrüche europäischer Geschichte deutlich zu Tage treten: wechselnde Besatzungen, Konfessionen, gerissene Lebenslinien.
Patrick Wellinski, Deutschlandfunk, 24.09.19
Eckdaten
Springer, Filip: Kupferberg: der verschwundene Ort / aus dem Polnischen übersetzt von Lisa Palmers. - Wien : Paul Zsolnay Verlag, 2019. -
ISBN 978-3-552-05908-5
Quelle : Hanser Literaturverlage
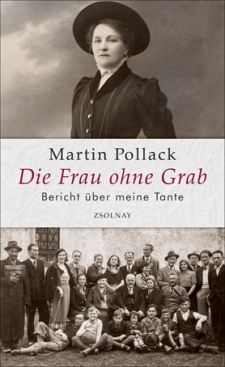
Martin Pollack
Die Frau ohne Grab
Bericht über meine Tante
Nach"Der Tote im Bunker" folgt Martin Pollack den Spuren seiner Tante, die am Ende des Zweiten Weltkriegs zu Tode kommt und deren Grab nie gefunden wird.
Sommer 1945: Die siebzigjährige Pauline Drolc, geborene Bast, wird von jugoslawischen Partisanen in ihrem Heimatort Tüffer, slowenisch Lasko, verhaftet und in das provisorische Internierungslager Schloss Hrastovec gebracht. Wenige Wochen später ist sie tot. Ihr Grab wird nie gefunden. Pauline ist die Großtante von Martin Pollack, dessen Buch über den eigenen Vater, SS-Sturmbannführer Gerhard Bast, zu den Meilensteinen der Erinnerungsliteratur zählt. Und sie ist die Einzige in der stramm deutschnationalen Familie, die am Ende des Zweiten Weltkriegs zu Tode kommt. In seinem detektivisch recherchierten Bericht erzählt Martin Pollack über das Schicksal eines Menschen, das beispielhaft ist für die historischen Verstrickungen an einem kleinen Ort zwischen den Grenzen.
Pressestimmen
Mit seinen beherzten familiären Erkundungsgängen hat Pollack das Gedächtnis des Landes nachhaltig bereichert.
Oliver vom Hove, Presse spectrum
Ein großes, genaues, erschütterndes Buch.
Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung
Martin Pollack ist ein Meister im Erschließen historischer Quellen. Je spärlicher sie fließen, desto mehr scheinen sie ihn zu interessieren. Auf der Grundlage von Fotos, Briefen und Gesprächen mit Zeitzeugen sowie dank detaillierter Kenntnis des historischen Kontextes ist es ihm gelungen, über seine Grosstante ein spannendes und gehaltvolles Buch zu schreiben – der schier hoffnungslosen Ausgangslage zum Trotz.
Manfred Papst, NZZ am Sonntag
Eine bemerkenswerte Studie über einen multikulturellen Mikrokosmos, der zum Spielball der ‚großen Geschichte‘ wird und in dem nationalistisch-völkische Ideologien das Zusammenleben immer wieder nicht nur stören, sondern zerstören.
Andreas Wirthensohn, Wiener Zeitung
Wer sich hierzulande mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, kommt an Pollack nicht vorbei. Pollack reist, recherchiert und reflektiert die große Geschichte anhand individueller Schicksale. Sein Schreiben ist schnörkellos und frei von Oberlehrerhaftigkeit, so präzise wie fundiert.
Wolfgang Paterno, profil
Martin Pollack ist ein Meister der dokumentarischen Prosa. Er hat ein untrügliches Gespür dafür, wie man mittels kleiner Geschichten von großer Geschichte erzählt.
Franziska Hirsbrunner, srf 52 Beste Bücher
Wieder ist Martin Pollack, diesem Experten für literarische Formen zwischen Geschichtsschreibung und Erzählprosa, ein Meisterwerk gelungen, das fesselt und sehr nachdenklich macht.
Christian Schacherreiter, Oberöstereichische Nachrichten
Ein spannendes Zeitdokument.
Katja Gasser, ORF
Mit seinem dokumentarischen Erzählen hat er so vieles vor dem Vergessenwerden bewahrt wie kaum ein Zweiter. Oft vereitelte Pollack, was die Mörder wollten – egal, ob Nazis oder Kommunisten: Sie wollten ihre Opfer zum Verschwinden bringen. Wenn möglich, hat er den Toten Namen und Geschichte zurückgegeben.
Peter Pisa, Kurier
Die beeindruckende Erzählung vom Schicksal einer Frau, die gänzlich ohne ihr Zutun zwischen die Fronten der Geschichte geraten ist, eine ebenso intime wie politische Spurensuche, Zeit- und Milieuschilderung. Vor allem aber große Literatur.
Gerhard Zeillinger, Der Standard
Eckdaten
Pollack, Martin: Die Frau ohne Grab: Bericht über meine Tante. - Wien: Zsolnay Verlag, 2019.
ISBN 9783552059511
Quelle : Hanser Literaturverlage
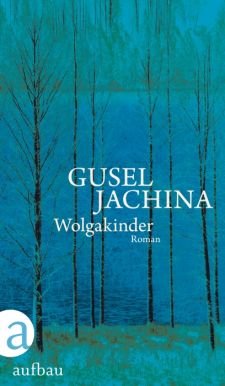
Gusel Jachina
Wolgakinder
Roman
In der Weite der Steppe am Unterlauf der Wolga siedeln seit dem achtzehnten Jahrhundert Deutsche. 1916 führt Jakob Bach in dem kleinen Dorf Gnadental ein einfaches Leben als Schulmeister, das geprägt ist von den Rhythmen der Natur. Sein Leben ändert sich schlagartig, als er sich in Klara verliebt, eine Bauerntochter vom anderen Ufer der Wolga. Doch ihre Liebe kann sich den Ereignissen nicht entziehen, die die Revolution und die Gründung der Deutschen Republik an der Wolga mit sich bringen.
(Klappentext)
Pressestimmen
Gusel Jachina fesselt ihre Leser von der ersten bis zur letzten Seite
Neue Zürcher Zeitung
Ihre Sprache ist extrem bildreich und gibt Orten, Klängen und Gerüchen eine geradeu sinnliche Qualität. Eindringlich vermittelt sich die Gewalt, der wachsende Horror, den die Menschen über den Zeitraum von zwei Jahrzehnten erleben. Beeindruckend ist zudem die kenntnisreiche, sehr versierte Behandlung der Geschichte der Russlanddeutschen.
Ein ausführlicher Apparat mit Anmerkungen reichert die stark individualisierte Geschichte mit historischem Hintergrundmaterial an.
Gewidmet hat Gusel Jachina ihren Roman dem Großvater, der als Deutschlehrer einer Dorfschule gearbeitet hatte.
Olga Hochweis, Deutschlandfunk Kultur
Gusel Jachina erzählt mit epischer Kraft die Geschichte der deutschen Siedler an der Wolga
Märkische LebensArt
Die russische Autorin Gusel Jachina erzählt in ihrem Roman "Wolgakinder" eine Geschichte, die in Russland wie in Deutschland verdrängt wird. Ein Roman, der nicht nur die Literatur verändern könnte
Märkische Oderzeitung
Und mehr noch, als bei ihrem vielbeachteten Erstling "Suleika öffnet die Augen", in dem sie die Jahre ihrer tatarischen Großmutter in der Verbannung beschreibt, schafft sie auch dieses Mal wieder ein erzählerisches Meisterwerk.
SFR, Schweizer Radio und Fernsehen
Gusel Jachina verwandelt diesen Stoff in eine großartige Geschichte - so, dass alles unsere Seele erreicht
Dresdner Neueste Nachrichten
Gusel Jachinas Fabulierkunst macht aus den dramatischen historischen Ereignissen ein episches, mit magischen Elementen ausgesponnenes Märchen
taz, Die Tageszeitung
Gusel Jachina erzählt eine märchenhaft-kafkaeske Geschichte über deutsche Siedler an der russischen Wolga in einer Zeitspanne zwischen 1916 und 1945
WDR, Westdeutscher Rundfunk
Es ist beeindruckend, mit wie viel Kraft und Raffinesse Gusel Jachina die Fäden der Vergangenheit zu einer festen Verbindung knüpft
Leipziger Volkszeitung
Eckdaten
Gusel Jachina : Wolgakinder: Roman. - Aus dem Russischen von Helmut Ettinger. - Berlin: Aufbau Verlag, 2019. - 591 Seiten
ISBN 978-3-351-03759-8
Quelle : Aufbau Verlag
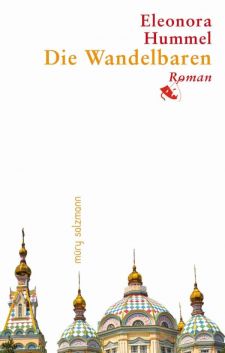
Eleonora Hummel
Die Wandelbaren
Roman
Traktorist will er werden und die schöne Tochter des Sowchose-Vorsitzenden heiraten. Doch es kommt anders. Feine Leute aus der Stadt engagieren Arnold Bungert, 16, quasi vom Feld der kasachischen Steppe weg, bei den besten Dozenten soll er die Schauspielkunst erlernen. In Moskau! Der Haken: Bühnensprache ist Deutsch, und Arnold Bungert kann kein Wort, trotz seines Namens. Mit ihm wird eine Handvoll Jugendlicher für das Deutsche Theater Temirtau ausgebildet, zur Förderung, so der Plan der Sowjetregierung, der deutschen Minderheit.
In der Metallurgenstadt Temirtau leben allerdings kaum Deutsche, das Publikum ist rar gesät. Dennoch schaffen sich die jungen Schauspieler eine kleine Insel der Freiheit im totalitären Sowjetregime. Sie schmieden politische Pläne, lieben, wetteifern, spielen um ihr Leben. 25 Jahre nach Auflösung des Theaters treffen sie sich wieder. Was ist von ihren Träumen geblieben?
Mit "Die Wandelbaren" legt Eleonora Hummel einen großen Roman vor: In der Tradition bester russischer Erzählkunst erweckt sie ein weithin unbekanntes Stück Wende-Geschichte zum prallen Leben und liefert obendrein eine Liebeserklärung an alle, die die Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und davon gemacht haben …
(Klappentext)
Pressestimmen
Eine vielstimmige Collage, ein großes Zeitbild voller Komik und Tragik. Die russischen Spezialisten für absurde Literatur haben eine kluge Nachfolgerin
Karin Großmann, Sächsische Zeitung
In diesen nüchternen, oft ein wenig sperrigen Sätzen kommen Lebensgeschichten daher, die einem an die Nieren gehen.
Thomas Gärtner, Dresdener Neueste Nachrichten
Eleonora Hummel blättert ein interessantes Kapitel deutscher Identität auf - beginnend in den 70ernJahren bis zur jüngsten Vergangenheit. Die Träume nach Ruhm und Anerkennung, das Sehnen nach Identität und Verbundenheit, das Hoffen auf einen Platz im sowjetischen Gefüge, um dort heimisch zu werden - dies alles wird unter dem Mühlstein der politischen Willkür zermahlt.
Andreas Kück, Leselust
Eckdaten
Eleonora Hummel: Die Wandelbaren: Roman. - Salzburg, Wien: Müry Salzmann, 2019. - 464 Seiten
ISBN: 978-3-99014-196-0
Quelle : Verlag
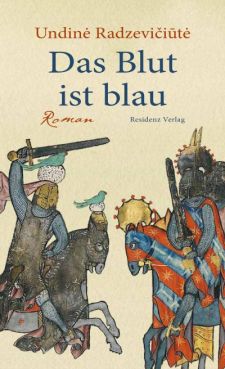
Undiné Radzevičiūtė
Das Blut ist blau
Roman
Die Geschichte einer Familie, deren Machtgier Europa prägte: die deutschen Borgia
Das deutsche Adelsgeschlecht von der Borch war nicht minder einflussreich und machtgierig als ihre italienischen Verwandten, die berühmten Borgia. An der Schwelle zwischen Mittelalter und früher Neuzeit kämpft Bernhard von der Borch, Landmeister des Deutschritterordens, in Livland um den Erhalt seiner Macht, er will einen neuen Kreuzzug gegen die Ostkirche ins Leben rufen – doch die Zeiten der Ritterlichkeit sind vorbei. Eine raffinierte Heiratspolitik soll ihn mit dem Zaren verbinden. Als er scheitert, kann nur mehr eine Reise nach Rom zu den berühmten Verwandten helfen.
Undiné Radzevičiūtė, in deren Adern das blaue Blut der Borchs fließt, folgt ihrer eigenen Familiengeschichte und erzählt fesselnd und gewitzt vom Kampf der letzten Ordensritter um ihre Vormachtstellung. Wird es Bernhard von der Borch gelingen, sich mit Putsch und Intrige in einer Welt zu behaupten, die bereits in Auflösung ist?
Pressestimmen
Mit ihrem eigenwilligen Erzählstil befreit Undiné Radzevičiūtė das Genre des historischen Romans vom Staub der Jahrhunderte.
Gudrun Braunsperger, DIE PRESSE
Undinė Radzevičiūtė kennt sich bestens in der Epoche aus; sie skizziert das Lebensgefühl des spätmittelalterlichen Rittertums; sie erkundet auch, was diese Ritter trieb: ob es plumpe Kriegslust oder Beutegier war oder aber das Ideal eines fairen Kampfes nach festen Regeln – oder doch noch der Vorsatz, das Evangelium zu verbreiten. (…) All dies hat Undinė Radzevičiūtė in eine detailreiche Romanhandlung verwandelt (…).
Michael Kuhlmann SWR LESENSWERT
Das Buch ist ein beeindruckendes Werk über eine der gefährlichsten Familien im Norden Europas an der Schwelle zwischen Mittelalter und Frühzeit. (…) Undiné Radzevičiūté berichtet vom Kampf der letzten Ordensritter um ihre Vormachtstellung. Entworfen wird eine graue Welt mit viel Schmutz, Machtmissbrauch und Gottgläubigkeit.
Imogena Doderer, ORF BESTENLISTE
Der Höhepunkt des Buches ist es Eintauchen zu können in eine Welt, die manche vielleicht einfach finsteres Mittelalter nennen würden. Solche Abqualifizierungen, verhindern aber auch manchmal näher hinzusehen. Undiné Radzevičiūtė schafft hier einen neuen Zugang – sicher nicht nur für litauische, sondern vor allem für europäisch orientierte Leserinnen und Leser. Wenn sie nicht schon den europäischen Literaturpreis bekommen hätte, auch dieses Buch liegt ganz auf dieser Linie.
Albert Caspari, Die baltische Stunde
Das epische Sujet mit seinen zahlreichen historischen Details und Akteuren steht dabei in einem eigenartigen Spannungsverhältnis zu dem lakonischen, kurzsilbigen Stil und den schnellen Dialogen, was eine durchaus reizvolle Lektüre bietet.
Dorothea Trottenberg, EKZ
Undiné Radzevičiūtė geht mit ihren Vorfahren hart ins Gericht, witzig und frech, bisweilen sogar mit ätzendem Humor und beißendem Spott. Dabei erspart sie ihren Lesern nichts, kein grausames Detail. (...) Hat man sich aber einmal darauf eingelassen, wird man belohnt.
Gudrun Braunsperger, Ö1 EX LIBRIS
Radzevičiūtė schreibt mit klarer, leicht verständlicher Sprache, die inhaltlich und historisch adaptiert ist.
Uschi Pirker, BIBLIOTHEKS NACHRICHTEN
Eckdaten
Undiné Radzevičiūtė: Das Blut ist blau: Roman. Aus dem Litauischen übersetz von Cornelius Hell. - Salzburg: Residenz Verlag, 2019. ISBN 978 3 7017 17002
Quelle : www.residenzverlag.com
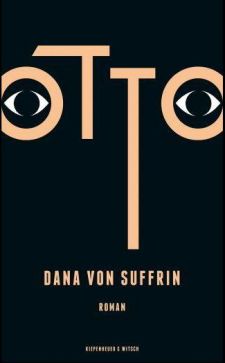
Dana von Suffrin
Otto
Roman
In ihrem Romandebüt erzählt Dana von Suffrin, was es heißt, wenn ein starrköpfiger jüdischer Familienpatriarch zum Pflegefall wird. Und wie schwer es fällt, von einem Menschen Abschied zu nehmen, den man sein ganzes Leben eigentlich loswerden wollte.
Für sein Umfeld war Otto, der pensionierte Ingenieur, schon immer eine Heimsuchung. Aber als er aus dem Krankenhaus zurückkehrt, ist alles noch viel schlimmer. Nach wie vor ist er aufbrausend, manipulativ, distanzlos und von wahnwitzigen Einfällen beseelt – aber jetzt ist er auch noch pflegebedürftig. Seinen erwachsenen Töchtern macht er unmissverständlich klar: Ich verlange, dass ihr für mich da seid. Und zwar immer! Für Timna und Babi beginnt ein Jahr voller unerwarteter Herausforderungen, aber auch der Begegnung mit der eigenen Vergangenheit und Familiengeschichte, die so schräg ist, dass Außenstehende nur den Kopf schütteln können. Klug, liebevoll und mit sehr viel schwarzem Humor erzählt Dana von Suffrin, wie Timna versucht, ihre dysfunktionale Familie zusammenzuhalten, ohne selbst vor die Hunde zu gehen. »Otto« ist Hommage und zugleich eine Abrechnung mit einem Mann, in dessen jüdischer Biografie sämtliche Abgründe des 20. Jahrhunderts aufscheinen.
Pressestimmen
Ein Mosaik der Erinnerungskultur. Ein Monument der Liebe.
Florian Leclerc, Frankfurter Rundschau
Man muss lachen, weil die Autorin mit so viel leisem Sarkasmus schreibt. Stiller, schwarzer Humor, der fast unbemerkt daherkommt, und wenn man ihn bemerkt, ist er schon um die Ecke verschwunden, um sich erneut an zu schleichen.
Christine Westermann, WDR Frau TV
Selten begegnet man in Romanen liebenswerteren, gemeineren, tragischeren und lustigeren Figuren als dem Helden in Dana von Suffrins brillanten Debüt.
Christoph Farkas, stern
Die Sprache, die Satzmelodie, [...] klingen, als entstammten sie direkt der jiddischen Literatur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, [...] nur jünger, weiblicher und aus dem Jahr 2019.
Felix Stephan, Süddeutsche Zeitung
Ein Leben im 21. Jahrhundert, mit den Narben und Albträumen des Vorherigen versehen.
Elmar Schenkel, FAZ
Ganz in der Tradition des jüdischen Humors [...] Ein Buch, das unter die Haut geht, zum Lachen und zum Weinen.
WDR 2
Dana von Suffrins Romandebüt beginnt auf der Intensivstation, und es endet auch dort. Und doch gehört dieses Buch mit seinem wunderbaren Humor und seiner erzählerischen Souveränität zu den erfreulichsten Neuerscheinungen in diesem Herbst.
Beate Berger, Vogue
Otto [...] knüpft an jiddische Erzähltraditionen an, modernisiert sie, holt sie in die Gegenwart, und ist außerdem wahnsinnig lustig. Ein kleines Wunder.
Süddeutsche Zeitung
fabelhaft, lustig, traurig, melodiös
Alexander Solloch, NDRkultur
Eckdaten
Dana von Suffrin: Otto : Roman.
Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2019.- 228 S. ISBN 9783462052572
Quelle : Kiepenheuer & Witsch
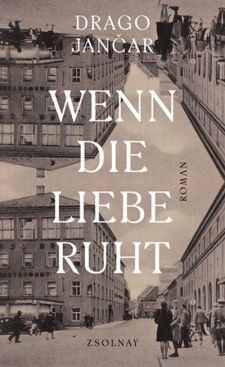
Draco Jančar
Wenn die Liebe ruht
Roman
Slowenien, Zweiter Weltkrieg: Die junge Medizinstudentin Sonja erkennt in dem SS-Offizier, den sie auf der Straße in Maribor trifft, Ludek wieder, der sie als Kind einmal beim Skifahren aus dem Schnee gezogen hat. Ludek heißt jetzt Ludwig und ist ein überzeugter Nazi. Sonja bittet ihn um Hilfe für ihren inhaftierten Freund Valentin. Für Ludwigs Hilfe zahlt Sonja einen hohen Preis. Doch Valentin, der bei den Partisanen kämpft und später im Kommunismus Karriere macht, dankt Sonja ihren Einsatz nicht. Stilistisch brillant lotet Jancar in seinem preisgekrönten Roman aus, wie weit wir bereit sind zu gehen, wie der Krieg Beziehungen neu formt und die Liebe, auch wenn das Leben weitergeht, in die Knie zwingt.
Pressestimmen
Ein Meisterwerk. Drago Jancar hat einen großen Roman über die blutigen Verwerfungen des Zwanzigsten Jahrhunderts geschrieben, über die korrumpierende Macht der Gewalt und die irreparablen Verstümmelungen, die Krieg und Völkermord in den Seelen der Menschen angerichtet haben.
Günter Kaindlstorfer, WDR5
Der allwissende Erzähler kommentiert nicht und enthält sich auch jeder sentimentalen Anwandlung. Gerade das verleiht dem mit nüchterner Eleganz erzählte Werk seine Glaubwürdigkeit, die Figuren machen mit ihren so plausiblen wie tragischen Handlungen die Widersprüche ihrer Zeit nachvollziehbar.
Johannes Bruggaier, Südkurier
Ein schillerndes Vexierspiel über Liebe und Tod, über Gut und Böse, Treue und Verrat, über Widerstand und Kollaboration.
Erich Klein, Ö1 ex libris
'Wenn die Liebe ruht' ist ganz großes Kino, das ist Weltliteratur. Ein formales Glanzstück.
Katja Gasser, ORF
Auf furiose Weise zeigt Jancar, welche Funken ein Autor aus dem Material der Geschichte zu schlagen vermag, wenn er der Schwerkraft der Chronologie einen souveränen Umgang mit den Zeitebenen entgegensetzt und gängige Mythen an der Komplexität seiner Figuren und ihrer Biografien zerschellen lässt.
Cornelius Hell, Die Presse
Unnachahmlich direkt verwebt Jancar darin persönliche Schicksale mit einer ganzen Epoche von Leid, Vertreibung und Verrat.
Ute Büsing, rbb Quergelesen
Kunstvoll entwirft Drago Jancar diesen Roman, verschachtelt Gegenwart und Vergangenheit, schaut auch schon mal in die weite Zukunft der Figuren, malt mit der Hingabe eines Genremalers die Szenen aus, windet die Handlung entschieden in die eine oder andere, oft überraschende, Richtung – doch er stößt immer auf die Härte des Daseins, die Ungerechtigkeit des Lebens wie des Todes.
Carsten Hueck, Deutschlandfunk
Drago Jancar ist ein großer Erzähler, und viele Szenen hallen lange nach.
Norbert Mappes-Niediek, Frankfurter Rundschau
Jančar hat einen historischen Roman geschrieben, der die Situation der Slowenen unter Herrschaft der Nazis genauso wie später unter den siegreichen Partisanen Titos plastisch darstellt. Und dabei erzählt, was es heißt, leben zu müssen, wenn die Liebe ruht.
Carsten Hueck, Deutschlandfunk
Eckdaten
Drago Jančar: Wenn die Liebe ruht : Roman. Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut.
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2019. 394 Seiten ISBN 9783552059658
Quelle : Hansa Literaturverlage

