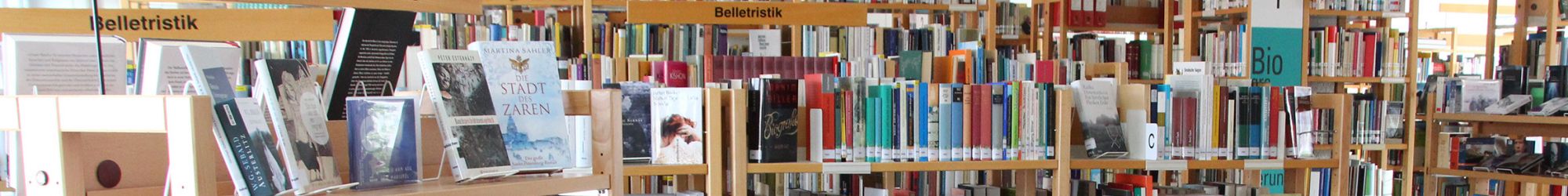Buchtipp des Monats - Belletristik
Jahresarchiv
- Belletristik
- Sachbuch
2019
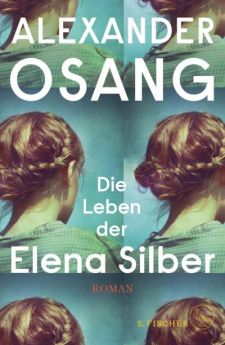
Alexander Osang
Die Leben der Elena Silber
Roman
Russland, Anfang des 20. Jahrhunderts. In einer kleinen Provinzstadt östlich von Moskau wird der Revolutionär Viktor Krasnow hingerichtet. Wie eine gewaltige Welle erfasst die Zeit in diesem Moment Viktors Tochter Lena. Sie heiratet den deutschen Textilingenieur Robert Silber und flieht mit diesem 1936 nach Berlin, als die politische Lage in der Sowjetunion gefährlich wird. In Schlesien überleben sie den Zweiten Weltkrieg, aber dann verschwindet Robert in den Wirren der Nachkriegszeit, und Elena muss ihre vier Töchter alleine durchbringen. Sie sollen den Weg weitergehen, den Elena begonnen hat zu gehen – hinaus aus einem zu engen Leben, weg vom Unglück. Doch stimmt diese Geschichte, wie Elena sie ihrer Familie immer wieder erzählt hat?
2017, mehr als zwanzig Jahre nach Elenas Tod, macht sich ihr Enkel, der Filmemacher Konstantin Stein, auf den Weg nach Russland. Er will die Geschichte des Jahrhunderts und seiner Familie verstehen, um sich selbst zu verstehen.
Pressestimmen
Osang ist ein großartiger Erzähler, sein Epos spannt mit Leichtigkeit einen Bogen über 100 Jahre Geschichte, die sich im einzelnen Schicksal widerspiegelt.
Meike Schnitzler, Brigitte
Alexander Osangs bislang persönlichster und größter Roman [...] aber er läge wohl auch bei einem Wettbewerb um den spektakulärsten ersten Satz ziemlich weit vorne.
Martin Halter, Frankfurter Allgemein Zeitung
Jetzt holt er, angelehnt an das Schicksal seiner Großmutter, zu einem zutiefst anrührenden Familienroman des zwanzigsten Jahrhunderst aus.
Rundfunk Berlin Brandenburg
Lektüre für alle, die sich ohne falsche Sentimentalität für die Dramen des 20. Jahrhunderts interessieren, aber auch für das Drama der Familie und des Älterwerdens.
Sabine Frank, MDR Mitteldeutscher Rundfunk
Alexander Osang macht einen großen Wurf [...]. Ein Autor, der etwas riskiert
Rainer Moritz, Norddeutscher Rundfunk
ein überaus ambitionierter Roman, der nicht nur ein Panorama des 20. Jahrhunderts aufzieht, sondern auch vom Erzählen und Erinnern selbst handelt
Maik Brüggemeyer, Deutschlandfunk
Eckdaten
Osang, Alexander: Die Leben der Elena Silber. Roman. -Frankfurt am Main: S. Fischer, 2019. ISBN-13 9783103974232
Quelle : S. Fischer Verlag
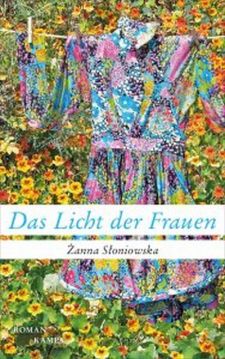
Żanna Słoniowska
Das Licht der Frauen
Roman
Die wichtigsten Revolutionen werden nicht auf der Straße ausgefochten, sondern in unseren Herzen.
Im Herzen von Lemberg – ein Haus mit einer ganz besonderen Glasmalerei. Hier leben vier Frauen, die einander ebenso lieben, wie sie sich hassen. Sie eint ihr Freiheitsdrang, ihre Aufsässigkeit – und ihre unglücklichen Lieben. Bis zu dem Tag, der alles verändert: Marianna wird auf offener Straße erschossen. Vom Fenster aus beobachtet ihre Tochter, wie sich der Trauerzug zu einer Demonstration auswächst. Marianna war nicht nur eine gefeierte Sängerin an der Lemberger Oper, sondern auch Aktivistin im Kampf für eine unabhängige Ukraine. Unter demselben Fenster steht Jahre später ein Mann, der Mariannas Tochter ihre Heimatstadt näherbringt – und die viel zu früh verstorbene Mutter.
Vor dem Hintergrund der bewegten Geschichte der Stadt Lemberg, die jahrhundertelang unter dem Einfluss unterschiedlicher politischer Mächte stand, erzählt Żanna Słoniowska von vier starken Frauen aus vier Generationen, von Müttern und Töchtern, von privaten und gesellschaftlichen Revolten, dem unbedingten Glauben an Freiheit, Emanzipation und an die Liebe.
Pressestimmen
"Das Licht der Frauen" verbindet die Lebenswege von vier Frauen aus vier Generationen einer Familie mit der multi-nationalen Geschichte der Stadt Lemberg, heute Lwiw.
… man sollte bei diesem preisgekrönten Debütroman auf keiner eindeutigen Interpretation bestehen, da dessen Stärke gerade in der Vieldeutigkeit der Erzählweise liegt. Woraus sich wiederum auch eine kleine Schwäche ergibt. (…)
Alles in allem ist es aber ein eindrucksvoller Roman, der auf subtile Weise den Einfluss der Geschichte auf das Leben des Einzelnen zeigt: Egal, wie lange man daran glaubt, sich der eigenen Herkunft entziehen zu können – irgendwann holt sie einen doch ein.
Marta Kijowska, Deutschlandfunk
Nur wenige Romane bewegen so sehr gleichermaßen Herz und Verstand.
Financial Times, London
Mein Polnisch ist durchmischt mit ukrainischen Volksliedern und russischer Literatur. Ich bin die erste Ausländerin, die auf Polnisch ein Buch geschrieben hat. Das war neu für die Polen.
Żanna Słoniowska
Eine fantastische Erzählerin, eine erstaunliche literarische Entdeckung.
Polityka, Warschau
Eckdaten
Żanna Słoniowska: Das Licht der Frauen, Kampa Verlag, Zürich, 2018
ISBN 9783311100034
Quelle : Kampa Verlag
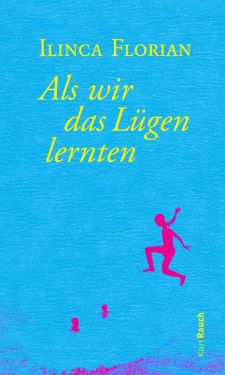
Illinca Florian
Als wir das Lügen lernten
Roman
Bukarest, Ende der achtziger Jahre. Der unbeschwerte Sommer, den die Familie am Schwarzen Meer verbracht hat, ist vorbei. Mit dem Herbst und der Rückkehr in die Großstadt ziehen auch die Sorgen des sozialistischen Alltags wieder ein. Die junge Erzählerin berichtet von der Welt der Erwachsenen, den feinen Rissen, die sie durchziehen, und der Frage, die über allem schwebt: Gehen oder bleiben? Sollen wir die Heimat verlassen und in eine Fremde reisen, die ein freies und unbeschwertes Leben verspricht? Die Mutter droht am nahenden Exil zu zerbrechen, und keiner ahnt, warum. Allein das Mädchen, die eigene Tochter, sieht mehr, bemerkt die kurzen, aber ungehaltenen Berührungen einerseits und warmen Blicke andererseits, es wird zum stillen Zeugen einer Liebschaft zwischen ihrer Mutter und einem anderen Mann. In direkter, unmittelbarer Sprache erzählt Ilinca Florian von einer Gesellschaft im Umbruch. Eine Geschichte voller heiterer Momente, dank einer kindlichen Erzählerin, die genau hinschaut, wo erwachsene Augen sich abwenden.
Pressestimmen
So zärtlich und dabei so bedrohlich ist noch nicht geschrieben worden über das Ende einer Kindheit. Unter jedem Satz lodert eine Lüge, während im Hintergrund Ceaușescus Rumänien zerfällt. Ilinca Florians Debüt ist ein stiller Orkan.
Lucy Fricke, Schriftstellerin
Wer Ilinca Florian liest, weiß: gegen Familie hilft nur Prosa, und gegen den Aberwitz der Zeitgeschichte helfen starke, leise Bilder.
Dana Grigorcea, Schriftstellerin
Ilinca Florian ist ein wunderbares Buch gelungen.
rbb kultur
Einfühlsam, mit leiser Poesie.
der Freitag
Ein Roman, der ein Stück europäische Gesellschaftsgeschichte beeindruckend öffnet.
BÜCHER-Magazin
Diese Autorin denkt sehr filmisch und setzt ihre Mittel hochbewusst ein. Die zugespitzte Sprache birgt in sich eine Mehrdeutigkeit, eine diffuse Stimmung mit vielen changierenden Grautönen, und das bleibt bis zum Schluss so, als die rumänische Familie in Stuttgart ankommt. (…) Ob das ein gutes Ende findet? Das Ende dieses Romans jedenfalls geht ganz konsequent aus dem Erzählen hervor.
Helmut Böttiger, Süddeutsche Zeitung
Das Schönste an diesem Roman ist seine Hauptfigur, die wach, fantasievoll und widerspenstig sehr viel sieht. Vielleicht mehr als Erwachsenenaugen je sehen könnten.
bücher.de
Eckdaten
Ilinca Florian: Als wir das Lügen lernten, Düsseldorf, Karl Rauch Verlag, 2018, ISBN-13 978-3-7920-0252-0
Quelle: https://karl-rauch-verlag.de
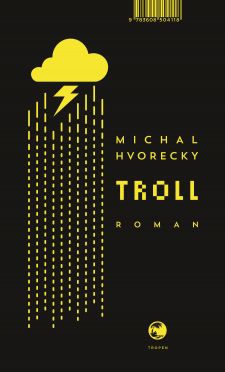
Michal Hvorecky
Troll
Roman
Osteuropa in naher Zukunft. Ein Heer aus Trollen beherrscht das Internet, kommentiert und hetzt. Zwei Freunde entwickeln immer stärkere Zweifel und beschließen, das System von innen heraus zu stören. Dabei geraten sie selbst in die Unkontrollierbarkeit der Netzwelt – und an die Grenzen ihres gegenseitigen Vertrauens. Die europäische Gemeinschaft ist zerfallen und wurde durch die Festung Europa ersetzt. Ihr gegenüber steht das diktatorisch geführte Reich, in dessen Protektoraten ein ganzes Heer von Internettrollen die öffentliche Meinung lenkt. Einer von ihnen ist der namenlose Held dieser in einer allzu naheliegenden Zukunft angesiedelten Geschichte. Gemeinsam mit seiner Verbündeten Johanna versucht er, das staatliche System der Fehlinformationen von innen heraus zu stören – und wird dabei selbst Opfer eines Shitstorms. Mit seiner rasanten, literarisch verdichteten Erzählung beweist Michal Hvorecky erneut, warum er der erfolgreichste Autor der Slowakei ist.
Pressestimmen
Ein wütender, frecher Text in einer rasanten, wendigen, niemals langweilig werdenden Sprache. Ich habe uns wiedererkannt, mich gegruselt und amüsiert
Terézia Mora, Süddeutsche Zeitung, 28.12.2018
Man sollte diese Dystopie lesen, wenn man die realen Möglichkeiten und die Auswirkungen des Phänomens Trolle kennen lernen will: Es ist ein Horror.
Otfried Käppeler, Südwest Presse
Schmerzlich führt uns der Roman vor, wie eine Gesellschaft aussieht, in der es keine Wahrheit, also auch keine Wissenschaft und keine unabhängigen Journalismus mehr gibt. Es geht nur noch darum, über die größte und mächtigste Trollarmee zu befehlen.
Niklas Prenzel, Falter
Michal Hvorecky hat ein aufklärerisches und kämpferisches Buch geschrieben.
Terry Albrecht, Deutschlandfunk: Büchermarkt
Dieses Buch erzählt vom Albtraum der Aufklärung. Von einer Welt, in der Wahrheit und Lüge gleich viel wert sind. Es spielt in einer nahen Zukunft, die sich aber wie eine unabwendbare Gegenwart anfühlt. Ein umnachtetes Europa, dem der Kompass abhanden gekommen ist, in der Hand derer, denen nichts mehr heilig ist. Ein mutiges Buch. Ein wichtiges Buch. Besser als Michal Hvorecky kann man die Wahrheit nicht erfinden.
David Schalko
In "Troll" steckt mehr als ein Körnchen aktueller Wirklichkeit. Immer wieder lässt der Autor eine bitterböse Satire auf heutige Zustände [...] aufblitzen
Aachner Zeitung
Rasend schnell wie ein populärer Hass-Hashtag stürzt der neue Roman von Michal Hvorecky auf seine Leser ein. Und ebenso fasziniert und abgestoßen wie von menschenverachtenden Beiträgen in der Timeline verschlingt man die 213 Seiten von "Troll"
Hamburger Abendblatt
[...] der Kern dieses Buches, die böse Farce um die Zersetzung einer Gesellschaft und des Wahrheitsbegriffs durch Internettrolle, die kommt einem doch schaurig vor.
Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung
Nach dieser Lektüre wird man das Internet anders betrachten.
Iris Tscharf, Der Blog der Schurken
Eckdaten
Hvorecky, Michal: Troll – Roman.- Stuttgart, Tropen 2019, ISBN 978-3-608-50411-8
Quelle : www.klett-cotta.de
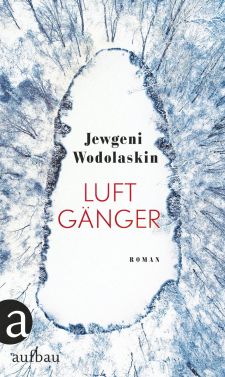
Jewgeni Wodolaskin
Luftgänger
Roman
Petersburg 1999: Als Innonkenti Platonow in einem Krankenhaus erwacht, kann er sich an nichts erinnern. Er leidet an einer totalen Amnesie.
Sein Arzt verrät ihm nur seinen Namen: Innokenti Platonow. Die erste Erinnerung hat Innokenti an seine Großmutter, die dem Kleinen „Robinson Crusoe“ vorliest. Ein Glücksgefühl, doch die Lektüre stimmt auch ein Motiv an, das den Verlauf des Romans wie eine traurige Melodie durchzieht: Einsamkeit und Verlorenheit. Eine weitere Insel, so rekonstruiert der Patient, hat sein Leben entscheidend beeinflusst, Erinnerungen an ein Lager, Erfahrungen von Verrat, Gewalt und Folter tauchen auf. Und Verluste: Sein Vater wurde von Matrosen erschlagen, der Vater seiner großen Liebe von der Polizei erschossen. Und Anastassija selbst, was ist aus ihr geworden?
Langsam formt sich das Bild eines bewegten Lebens: Eine behütete Kindheit im Russland der Zarenzeit, der Sturm der Revolution, roter Terror und der Verlust einer ersten großen Liebe. Bald treibt ihn vor allem eine Frage um: Wie kann er sich an den Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts erinnern, wenn die Tabletten auf seinem Nachttisch aus dem Jahr 1999 stammen?
In der Tradition großer russischer Autoren wie Michail Bulgakow und Fjodor Dostojewski entfaltet Jewgeni Wodolaskin am Schicksal eines Einzelnen ein faszinierendes Panorama Russlands.
Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Jewgeni Wodolaskin, 1964 geboren, gilt schon seit Längerem als einer der interessantesten russischen Autoren. Seit mehr als dreißig Jahren arbeitet er in Petersburg am Puschkinhaus, dem Institut für Russische Literatur. Historische Fachbücher und drei Romane hat er veröffentlicht. Für sein Gesamtwerk erhält er nun den Solschenizyn-Preis, der von Alexander Solschenizyn ins Leben gerufen wurde und seit 1997 verliehen wird.
Pressestimmen
Eine faszinierende Jahrhundertchronik Russlands.
BBC
Zauberhaft melancholisch und dennoch mitreißend schildert der russische Bestsellerautor Wodolaskin die Geschehnisse und entführt in eine fremde Welt.
Westfalenpost
Ein unvergessliches und bis zum letzten Satz spennendes und mit atmosphärischem Gespür verfasstes Buch.
SAX- Das Dresdener Stadtmagazin
Es ist die berühmte russische Seele, die hier beharrlich beschworen wird.
Der SPIEGEL
Ein Highlight dieses Bücherfrühlings.
Dresdner Kulturmagazin
Bis zur letzten Seite bleibt dieses mit großer Meisterschaft und Gespür für Atmosphäre geschriebene Buch spannend. Wirklich unvergesslich.
Sächsische Zeitung
Wodolaskin lässt das russische 20. Jahrhundert Revue passieren und stellt aus ungewöhnlicher Perspektive die Frage nach Schuld und Unschuld. Eine große Erzählung und eine vielfältige Bereicherung.
Die Presse
„Luftgänger“ ist eines der schönsten Bücher, die dieser Frühling hervorgebracht hat.
Magazin
Stell dir vor Eisblüten wären konservierbar, hier ist ein Strauß der schönsten Blüten.
radioeins Literaturagenten
"Luftgänger" ist ein raffiniertes, intellektuelles und doch unterhaltsames Kaleidoskop der Geschichte, das am Ende sogar ein kriminologisches Geheimnis verbirgt.
Neue Zürcher Zeitung am Sonntag
Eines ist sicher: Mit Wodolsakin „Luftgänger“ wurde die russische Literatur tatsächlich wiedergeboren!
Österreich
In der Literatur lassen sich Raum und Zeit aufheben - das zeigt uns dieser Roman auf grandiose Weise.
Dresdner Neueste Nachrichten
Diesen Roman zu vergessen, ist schier unmöglich.
Nordkurier
Der Roman ist ein gelehrtes poetisches, moralisches Wortkunstwerk über einen gefährlichen Weg auf fragilem Gefährt.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Der bewegende neue Roman des „russischen Umberto Eco
Financial Times
Eckdaten
Jewgeni Wodolaskin : Luftgänger, Roman - Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt. -Berlin: Aufbau Verlag , 2019. 429 Seiten. ISBN 978-3-351-03704-8
Quelle : Aufbau Verlag
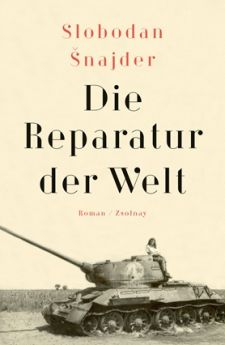
Slobodan Šnajder
Die Reparatur der Welt
Roman
Die Gesandten Maria Theresias kommen in die Hungergebiete des Schwabenlandes und locken Urvater Kempf nach "Transsilvanien". Schnell werden die Siedler, die auf einem Floß donauaufwärts reisen, in Slawonien heimisch.
Mehr als 150 Jahre später kommen erneut Gesandte, die die sogenannten Volksdeutschen heim ins Reich holen und für die Waffen-SS rekrutieren sollen. Der Dichter Georg Kempf wird an die Ostfront geschickt, desertiert und kehrt nach Kriegsende nach Jugoslawien zurück, weil ihm die Russen schriftlich attestieren, "für die richtige Sache" gekämpft zu haben. Georg freundet sich mit der Partisanin Vera an, sie heiraten. Doch die Geschichte und die unterschiedlichen ideologischen Welten, aus denen sie stammen, machen es ihnen schwer, einen gemeinsamen Weg zu gehen. In Die Reparatur der Welt zeichnet Slobodan Šnajder sprachmächtig und handlungsstark das Schicksal einer Familie in den Extremen des 20. Jahrhunderts nach. Das Buch ist einer der imposantesten Romane der europäischen Gegenwartsliteratur.
Pressestimmen
Aus ungewöhnlichen Blickwinkeln, in beeindruckender stilistischer Vielfalt, manchmal obszön, niemals pathetisch und allemal spannend schildert dieser Roman ein europäisches Schicksal im 20. Jahrhundert.
Martin Sander, SRW2 lesenswert
Šnajder gelingen beklemmende, tief empfundene Szenen, die lange hängen bleiben.
Norbert Mappes-Niediek, Frankfurter Rundschau
Šnajders eindrucksvoller, humaner Roman verkündet keine Botschaft, er richtet ein durchdringendes Auge auf eine irreparabel erscheinende Welt.
Gisela Trahm, Tagesspiegel
Ein großes Buch über das Europa der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Erich Klein, Falter
'Die Reparatur der Welt' ist eine dieser seltenen Preziosen und dazu noch ein europäischer Epochenroman, der seinesgleichen sucht.
Cornelius Hell, Ö1 ex libris
Mit faszinierender Intensität entwirft Šnajder ein an Kontrasten reiches Geschichten- und Geschichtspanorama. … Er erspart seiner Leserschaft nichts. Aber enorm weit ist sein Horizont, imposant seine Kunst, dem halbwegs intakten Kleinen das oft klägliche große Ganze gegenüberzustellen. Er entlarvt, er enthüllt, er demaskiert.
Werner Krause, Kleine Zeitung
Eckdaten
Šnajder, Slobodan: Die Reparatur der Welt, Roman. Aus dem Kroatischen von Mirjana und Klaus Wittmann. Wien: Zsolnay, 2019. ISBN-978-3-552-05924-5
Quelle : Zsolnay-Verlag
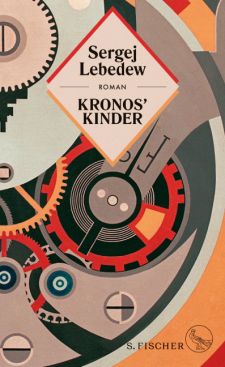
Sergej Lebedew
Kronos Kinder
Roman
Kirill ist noch ein kleiner Junge, als er am Verhalten der Erwachsenen merkt, dass das Verhältnis zwischen Russen und Deutschen ein besonderes sein muss. Seine Großmutter Karolina, die letzte Überlebende des deutschen Familienzweigs, erzählt ihm so manche Geschichte, bis Kirill erwachsen ist und selbst auf die Suche nach seinen Wurzeln geht. Auf dem deutschen Friedhof in Moskau findet er den Anfang seiner Geschichte, das Grab von Balthasar Schwerdt. Der deutsche Arzt und Homöopath wurde einst an den Hof des Zaren geholt, fiel aber wenige Jahre später in Ungnade und praktizierte fortan in Moskau.
In den Archiven von Leipzig, Halle, Münster und Wittenberg findet Kirill quer durch zwei Jahrhunderte deutsch-russische Familiengeschichte. Irgendeiner war immer involviert in die Russische Revolution, den Ersten oder Zweiten Weltkrieg und die Stalinzeit.
Nicht unmöglich, dass sich in der Schlacht von Stalingrad zwei Verwandte als Feinde gegenüberstanden.
Dank „Kronos‘ Kinder“ versteht man einmal mehr, was seit Katharina der Großen Deutsche und Russen verbindet und spaltet.
Für »Kronos‘ Kinder« hat Sergej Lebedew in den Archiven von Halle und Berlin seine deutschen Wurzeln recherchiert. Lebedew arbeitete nach dem Studium der Geologie als Journalist. Gegenstand seiner Romane sind für den 1981 Geborenen die russische Vergangenheit, insbesondere die Stalin-Zeit mit ihren Folgen für das moderne Russland. Lebedew lebt in Berlin.
Pressestimmen
Kronos’ Kinder“ ist ein wilder Mix aus Recherche und Erfindung, Mythologie und Poesie. Lebedews Alter Ego Kirill, inzwischen zum ausgebildeten Historiker gereift, macht sich auf die Reise, um in deutschen Archiven die letzten 200 Jahre seiner Familiengeschichte zusammenzustückeln. Er fährt auch nach Stalingrad, wo sich spätere Vorfahren gegenseitig in die Zielfernrohre genommen hatten, und nach Leningrad, wo einige von ihnen verhungert waren. Und er reist in die Phantasie. (…)Dichtung sei die ideale Recherchemethode dort, wo Datenketten abreißen. Findet Kirill eine fehlende Figur seines Puzzles nicht im Archiv, wo die „Ersatzmänner der Geschichte“ hausen, die „Personen zweiten Ranges“, dann erscheint sie ihm wie aus dem Jenseits. Ein Buch wie eine Séance.
Harald Jähner, Frankfurter Rundschau
[Es gelingt] Sergej Lebedew die Geschichte der Russlanddeutschen im Zarenreich und der Sowjetunion mit dem passionierten Blick eines Nachgeborenen eindrucksvoll in Erinnerung zu rufen.
Eberhard Falcke, Deutschlandfunk
Lebedews Stärke liegt in der Gestaltung einzelner Szenen. Hier zeichnet er detailreich die Atmosphäre einer Epoche nach. Die desolate Wirtschaftssituation in den neunziger Jahren, ein wiederkehrendes Thema bei ihm, stellt er ebenso packend dar wie den russisch-japanischen Krieg, die Leningrader Blockade, die Enteignungen der Deutschen während der beiden Weltkriege oder das zunehmende Misstrauen der Menschen untereinander. Einwanderung charakterisiert er letztlich als Geschäft, bei dem es auf allen Seiten um Märkte und billige Arbeitskräfte geht. Wie es in der ereignisdichten ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts gärt, wie jeder seine Schäflein ins Trockene bringen will, stellt er an Einzelbeispielen plastisch dar. Angst und Gier - das sind die Triebfedern menschlichen Tuns. (…)Und die Moral von der Geschichte? Was auch immer Russen und Deutsche verbindet - eines lässt sich über den Menschen festhalten: Er ist dem anderen ein Wolf.
Christiane Pöhlmann, FAZ
Der Reiz von Lebedews Roman liegt darin, dass er nicht einfach Begebenheiten einer Familiengeschichte in chronologischer Ordnung aufreiht. Das Aufarbeiten der Geschichte ist ebenso spannend wie die Geschichte selbst. Überdies gelingt es Lebedew, in seinem grossen Überblick historische Grundkonstanten herauszuarbeiten.
Er vergleicht die Hexenjagd auf die deutschsprachigen Bürger Russlands während des Ersten Weltkriegs mit den gegenseitigen Verdächtigungen in der Stalinzeit und der Verfolgung Andersdenkender im heutigen Russland.
Ulrich M. Schmid, Neue Züricher Zeitung
Die Qualität und - zumindest für deutsche Leser - die Provokation des Romans besteht darin, dass Lebedew in der sich steigernden Verfolgung einer Minderheit nicht nur eine Folge, sondern geradezu eine Bedingung des Totalitarismus sieht - und diese Minderheit sind die Deutschen.
(…)Aus der Perspektive eines Russen hat diese Reihung aber nichts Relativierendes, Weinerliches, sie zeigt, im Gegenteil, den Mechanismus in seiner ganzen Schäbigkeit. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion schien alle Vorurteile zu bestätigen, die Deutschen in Russland wurden deportiert, enteignet waren sie längst. Täter oder Opfer - das ist hier, wie so oft, vor allem eine Frage der Gelegenheit.
Sonja Zekri, Süddeutsche Zeitung
Eckdaten
Sergej Lebedew: Kronos' Kinder - Roman. Aus dem Russischen von Franziska Zwerg.- Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2018.-
ISBN 783103973730
Quelle : S. Fischer Verlag
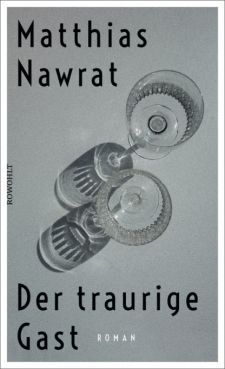
Nawrat, Matthias
Der traurige Gast
Roman
„Die Zeit, so dachte ich in diesem Augenblick, ist zirkulär, faltet sich, wenn ich will, über sich selbst, sodass mein jetziges Leben in Berührung kommt mit dem schon vergangenen und gleichzeitig die Unendlichkeit in Berührung kommt mit ihrer eigenen Unmöglichkeit, während wir auf diesem Planeten, in dieser Stadt, in diesem Weltjetzt durchs Weltall fliegen.“
Der Gast ohne Namen ist ein höflicher Mann. Er sitzt im Souterrain, bei Dariusz, mit dem er an der Shell-Tankstelle arbeitet, sitzt mit Karsten, dem früheren Studienkollegen, in einer Bar nahe der Charité, wo der als Molekularbiologe beschäftigt ist. Oder bei der alten polnischen Architektin Dorota, die ihm – zu gummiartigem Gebäck von überwältigend neutralem Geschmack – ihre Lebensgeschichte serviert, ihn ungefragt mitnimmt in die Stadtgeschichte Berlins, in die Philosophie und Geschichte jüdischen Lebens durch die Jahrhunderte. Der namenlose Gast hört zu. Über Gespräche und Begegnungen sucht er Antworten auf die Frage nach dem Wesen des Menschen, dem Leben, dem Tod. Umso tiefer trifft es ihn, dass er am Tag nach seinem Geburtstag in einer leergeräumten Wohnung steht. Frau Dorota, sagt der Vermieter, hat sich in ihrem Schlafzimmer erhängt.
„Der traurige Gast“ ist eine Selbst- und Weltbefragung von bestrickender erzählerischer Intensität. Ein philosophischer und zutiefst menschlicher Roman, der weiß, was Verlieren, Verdrängen, Neuankommen bedeutet. Ein Buch vom Überleben in aller Schönheit, trotz allem Schrecken.
Pressestimmen
'Der traurige Gast' ist eine Sinnsuche, ein Versuch, in einer Welt ohne Gott und Jenseitshoffnung doch irgendwelche Gründe oder auch nur Verhaltensmodi gegen die Verzweiflung zu finden ... ein großes Buch.
Welt am Sonntag
Matthias Nawrat hat mit „Der traurige Gast“ ein literarisches Kunstwerk geschrieben. Der Roman steckt voller existentieller Not, voller Erkenntnisse, gerade auch niederschmetternder angesichts dieser ewigen Gleichgültigkeit der Natur und der Zeit.
Die universelle Verlorenheit des Menschen, und das macht nicht zuletzt die Größe dieses Romans aus, die hat Nawrat in einer tragfähigen und schönen Form festgehalten, jenseits aller literarischen Moden.
Gerrit Bartels, SWR2
Subtil führt Nawrat Begriffe wie Lebensplanung oder Kontinuität ad absurdum; unaufdringlich, aber stets vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen und Verletzungen.
„Der traurige Gast“ ist ein leiser, aber dringlicher Roman; geschrieben in einer assoziationsreichen Sprache, die auch Raum lässt für einen tröstlichen Funken Resthoffnung.
Christoph Schröder, Deutschlandfunk
Der herrliche Erzähler Matthias Nawrat hat uns eingewickelt, im besten dichterischen Sinn.
Feridun Zaimoglu
Ein namenloser, schemenhaft bleibender Erzähler streift durch die Stadt, landet bei einer polnischen Architektin und kommt mit ihr ins Gespräch. Matthias Nawrats in klarer Sprache verfasster Roman ist von einem weltumfassenden Schmerz getragen.
Gabriele von Arnim, Deutschlandfunk, Buchkritik
(…) Kernmotiv des Romans: migrantische Entwurzelung und Verlorenheit. Die Geschichte der traurigen Gäste, von denen er erzählt, führt tief ins 20. Jahrhundert. Aber sie ist kein abgelegtes Kapitel. Sie steht im Dialog mit der Geschichte der traurigen Gäste des 21. Jahrhunderts, den Flüchtlingen von heute. (…) Ohne historische Simulation und Kulissengeschiebe, ohne sentimentale Schicksalseinfühlung und Reduzierung der Historie auf einen Plot bildet er Vergangenheit ab. Sein Ausgangspunkt ist immer die Gegenwart, sein Instrument eine genaue, im Ton gelassene Sprache.
Kein anderes Thema hat die Literaturkritik in den vergangenen Monaten so umgetrieben wie das Verhältnis von Fiktion und historischer Wahrheit. Da erscheint „Der traurige Gast“ von Matthias Nawrat genau im richtigen Moment. Denn dieser Roman zeigt, wie das Verhältnis im besten Fall beschaffen sein kann.
Ursula März, Die Zeit
Eckdaten
Matthias Nawrat: Der traurige Gast. Roman.- Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 2019.- ISBN 978 3 498 047047
Quelle : Rowohlt Verlag
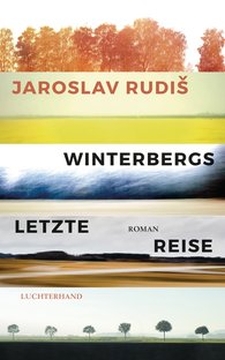
Jaroslav Rudiš
Winterbergs letzte Reise
Roman
Jan Kraus arbeitet als Altenpfleger in Berlin. Geboren ist er in Vimperk, dem früheren Winterberg, im Böhmerwald, seit 1986 lebt er in Deutschland. Unter welchen Umständen er die Tschechoslowakei verlassen hat, das bleibt sein Geheimnis. Und sein Trauma. Kraus begleitet Schwerkranke in den letzten Tagen ihres Lebens. Die Tage, Wochen, Monate, die er mit seinen Patienten verbringt, nennt er „Überfahrt“. Einer von denen, die er auf der Überfahrt begleiten soll, ist Wenzel Winterberg, geboren 1918 in Liberec, Reichenberg. Als Sudetendeutscher wurde er nach dem Krieg aus der Tschechoslowakei vertrieben. Als Kraus ihn kennenlernt, liegt er gelähmt und abwesend im Bett. Es sind Kraus' Erzählungen aus seiner Heimat Vimperk, die Winterberg aufwecken und ins Leben zurückholen. Doch Winterberg will mehr von Kraus, er will mit ihm eine letzte Reise antreten, auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe – eine Reise, die die beiden durch die Geschichte Mitteleuropas führt. Von Berlin nach Sarajevo über Reichenberg, Prag, Wien und Budapest. Denn nicht nur Kraus, auch Winterberg verbirgt ein Geheimnis.
Pressestimmen
Rudiš ist gegenwärtig einer der interessantesten Autoren seiner Breiten, weil er die Entwicklungen mitlebt, ein Ohr für die Historie hat.
Dirk Schürmer, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Eine mitreißende, melancholische und hochkomische Roadnovel, deren Held seinen illustren Ahnen von Charlie Chaplins The Tramp bis zu Sal Paradise in Jack Kerouacs Unterwegs alle Ehre macht.
Nicole Henneberg , Der Tagesspiegel
Winterbergs letzte Reise rattert dahin wie auf Schienen. Das Buch bezeichnet ein Vorstellungsgespinst, eine imaginäre Heimat, die uns Nachgeborene in Böhmen und in Österreich mit Schuld belädt. Sie versieht uns aber auch mit allen Annehmlichkeiten einer miteinander geteilten Identität. Vor allem aber dürften Winterberg und Kraus, zwei faszinierende Exponenten des alten Europas, Don Quijote und Sancho Pansa auf gemeinsamer Todesfahrt, über leistungsfähige Bahnermäßigungskarten verfügen. Die Preiswürdigkeit dieses famosen Romans ist evident.
Ronald Pohl, Der Standart
Jaroslav Rudiš hantiert mit dem Wort wie ein Jongleur mit zwei Dutzend Bällen, Tellern und Ringen. Nichts fällt runter. Es wirkt alles sehr unangestrengt.
Karin Grossmann, Sächsische Zeitung
Es treibt ihn, Geschichten und Geschichte kund zu tun - egal wie. Hauptsache, sie berühren die Seele.
Katrin Schumacher, MDR artour
Mit großer Erzählfreude häuft Rudiš einen Geschichten-Berg aus Vergangenheit und Gegenwart an - und schafft es, dass man Winterbergs letzte Reise einfach nicht abbrechen will.
Birgit Zimmermann, dpa
Winterbergs letzte Reise ist ein großer europäischer Roman über das Zuhören, aber auch über kulturelle Verunsicherungen und über geschichtliche Zusammenhänge.
Manja Reinhardt, Freie Presse
In diesem Buch stehen die Geschichten im Überfluss - lesen wir sie, verstehen wir vielleicht besser, was heute nicht mehr in Ordnung ist.
Felix Bayer, Literatur SPIEGEL
Eckdaten
Jaroslav Rudiš: Winterbergs letzte Reise, Roman. München: Luchterhand Literaturverlag, 2019, ISBN 978-3-630-87595-8
Quelle : Luchterhand Literaturverlag
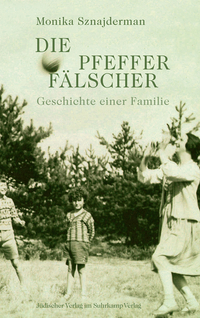
Monika Sznajderman
Die Pfefferfälscher
Geschichte einer Familie
Aus dem Polnischen und mit einem Nachwort von Martin Pollack
Jahrzehntelang lebte Monika Sznajderman im Schatten des Schweigens. Ihr Vater hatte über seine Odyssee durch die Konzentrations- und Vernichtungslager, seine Flucht und die Rückkehr nach Warschau nie sprechen wollen. Bis die Fotos aus Übersee kamen: Absender waren Verwandte, von deren Existenz sie nichts gewusst hatte. Sie beginnt zu recherchieren. Wenige Dokumente im Stadtarchiv von Radom und der Bericht des einzigen Überlebenden, des Großonkels Eliasz Sznajderman, im Holocaust Museum in Washington – mehr Spuren hat die große Familie in Polen nicht hinterlassen.
Im Gegensatz zu ihnen, »gewöhnlichen Menschen ohne Geschichte«, sind die polnischen Vorfahren der Mutter Angehörige der Oberschicht, national und antisemitisch eingestellte Gutsbesitzer und Unternehmer, die nach den Regeln und Gesetzen ihrer Klasse leben. Monika Sznajderman ist in ihren Recherchen weit fortgeschritten, als sie entdecken muss, dass etwa zur selben Zeit, als ein bekannter Künstler ihre elegante polnische Großmutter auf einem Gemälde verewigte, zweihundertfünfzig Kilometer weiter östlich ihre jüdische Großmutter von Ukrainern erschlagen wurde.
Die Geschichte, die Monika Sznajderman aus Interviews, Briefen, Fotos und veröffentlichten Quellen rekonstruiert, spricht mit seltener Eindringlichkeit von der Tragik des jahrhundertelangen polnisch-jüdischen Zusammenlebens, die nicht nur ihre Familie, sondern die ganze Gesellschaft bis heute nicht loslässt.
Pressestimmen
Es ist eine sehr persönliche, so spannende wie traurige Geschichte.
Hans-Peter Kunisch, Süddeutsche Zeitung
Es besteht kein Zweifel, dass die Autorin ... mit den einen mitleidet und sich für die anderen mitschuldig fühlt. Doch sie vergisst gleichzeitig nicht, dass zusammen mit der Welt ihrer jüdischen Vorfahren auch die ihrer polnischen Familie zerstört wurde ... Sie sei also ›Zeugin eines doppelten Weltendes‹ ... Auf eindringlichere Weise kann man die Tragik der polnisch-jüdischen Geschichte kaum zusammenfassen.
Marta Kijowska, Frankfurter Allgemeine Zeitung
[Monika Sznajdermans] aufklärerischer Arbeit, die weit über Familiengeschichtliches hinausgeht, gebührt größter Respekt – und dem Übersetzer Martin Pollack aufrichtiger Dank.
Ilma Rakusa, Neue Zürcher Zeitung
Die Fragen, die Sznajderman an ihre Angehörigen richtet, dürften ein Echo in vielen Familien finden, wenn die Nachkriegsgeneration Rechenschaft fordert
dpa, Frankfurter Neue Presse
Monika Sznajderman irrte durch ein Labyrinth winziger Familien-Eckdaten und holte eine nicht mehr zurückzuholende Vergangenheit erinnernd für ihre Leserinnen und Leser in ihr bemerkenswertes Buch zurück.t
Nea Weissberg, AVIVA-Berlin
Das Buch ist eine sehr persönliche, aber weit darüber hinaus interessante, ebenso spannende, wie traurige Geschichte.
Hans-Peter Kunisch, WDR
Die Pfefferfälscher‹ ... ist ein persönliches, zartes, mitunter fast intimes und trauriges Buch, gleichzeitig aber auch ein kraftvolles Plädoyer gegen die Geschichtsfälscher von heute.
Max Bloch, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 10/2018
Ein inhaltlich und stilistisch anspruchsvolles, eindringliches Zeitdokument.
Monika Graf, Borromäusverein Bonn, Buchprofile/Medienprofile Jg. 63/2018 Heft 3
Eckdaten
Monika Sznajderman: Die Pfefferfälscher Geschichte einer Familie, Aus dem Polnischen von Martin Pollack, Berlin: Suhrkamp, 2018
ISBN: 978-3-633-54290-1
Quelle : www.suhrkamp.de
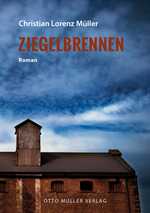
Christian Lorenz Müller
Ziegelbrennen
Roman
„Warum eigentlich Raimund?“, fragt sich Rosmarinka mit beinahe neunzig Jahren. Die gebürtige Kroatin hätte wohl ihr ganzes Leben in ihrem Heimatdorf verbracht, wäre sie als junges Mädchen nicht ausgerechnet an den Donauschwaben Raimund Quendler geraten. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs bedrängen Titos Partisanen den Hof der Quendlers, und so flieht die Familie nach Österreich, wo ein Neuanfang nur unter großen Entbehrungen gelingt. Rosmarinkas Sohn Anton soll es einmal besser haben und Priester werden, aber er bricht das Studium ab, ohne Gründe dafür zu nennen. Erst Jahrzehnte später, als der Historiker Arthur, der mit Rosmarinkas Enkelin Valentina liiert ist, nachfragt, beginnt die alte Frau zu erzählen. Bild fügt sich an Bild und ein Zusammenhang nach dem anderen erschließt sich. „Ziegelbrennen“ ist eine weit ausgreifende Familiengeschichte, ein Chor aus vielen Stimmen, die scheinbar sprunghaft wechseln: Zwischen der Zeit der faschistischen Ustascha-Diktatur in Kroatien während des Zweiten Weltkriegs, den Ereignissen der 1990er Jahre auf dem Balkan und der unmittelbaren Gegenwart: Denn im Herbst 2015 zogen zehntausende von Syrern, Irakern, Afghanen durch den Osten Kroatiens. Dort, in jener Gegend, in der Rosmarinka aufgewachsen ist, beginnt und endet dieser große Roman, der siebzig Jahre mitteleuropäischer Geschichte umspannt.
Pressestimmen
Christian Lorenz Müller hat einen großartigen Familienroman geschrieben, in den Welt- und Regionalgeschichte unprätentiös und leicht hineinfließen.
Clementine Skorpil, Die Presse am Sonntag
Mit Ziegelbrennen ist Müller ein vorzüglicher Roman gelungen: In seiner Sprache leuchten viele aparte Wörter und ausdrucksvolle Bilder hervor. Er verknüpft Familienschicksal und Politik und macht das lange Nachschwelen von Gewalt deutlich.
Hedwig Kainberger, Salzburger Nachrichten
Christian Lorenz Müller erzählt so eindrücklich, so lebendig, er hält so raffiniert, teils witzig, teils erschreckend, jedenfalls aber eigentümliche Ereignisse fest, und er beschreibt seie Protagonisten so prägnant und einfühlsam, dass man mühelos zwischen Kroatien und Österreich wie zwischen Heute und den Vergangenheiten vor 50 oder 30 Jahren hin und her liest. Die Bauweise des Romans erinnert an die darin erwähnte Sonntagsfrisur donauschwäbischer Frauen in Sveti Ivan, die ihren Zopf schneckig aufstecken: Die Erzählstränge werden nach und nach verflochten und zu einem Panorama aufgebaut, wobei sich manches, zuerst scheinbarzufällig Erwähnte zueinanderfügt.
Salzburger Nachrichten
In vielen Klangfarben überzeugt dieser Roman der Vielstimmigkeit in realistischer Erzählweise mit Fantsieeinschüben, im Konkreten wie im Übertragenen.
Klaus Zeyringer, Der Standard
Eckdaten
Christian Lorenz Müller: Ziegelbrennen Roman, Salzburg-Wien, Otto Müller Verlag, 2018, 502 Seiten
ISBN 9783701312627
Quelle : http://www.omvs.at
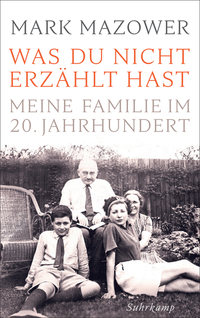
Mark Mazower
Was du nicht erzählt hast
Meine Familie im 20. Jahrhundert
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff
Als sein Vater stirbt und er herausfinden soll, wie seine Großeltern bestattet wurden, tut Mark Mazower, was ein Historiker am besten kann: Er macht sich an die Archivarbeit. Schnell wird ihm klar, wie wenig er über seine Familie weiß. Und so beginnt Mazower, die bewegten Biografien seiner Vorfahren zu erforschen. Etwa die seines Großvaters Max, der als Mitglied des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbundes in Vilnius revolutionäre Schriften verbreitete, bevor er vor den Wirren des russischen Bürgerkriegs nach Großbritannien floh – der vier Sprachen beherrschte und später doch kein Wort über seine Vergangenheit verlor. Oder die von Max’ unehelichem Sohn, André, dem schwarzen Schaf der Familie, der mehrmals seine Nationalität wechselte, sich zeitweise im faschistischen Spanien niederließ und eine verschwörungstheoretische Abhandlung über die angeblichen Machenschaften eines jüdischen Geheimbundes verfasste.
Mit großer Einfühlsamkeit zeichnet Mazower die Lebenswege seiner Angehörigen nach, die kreuz und quer über die historische Landkarte unseres Kontinents verlaufen: von der Sowjetunion während des Großen Terrors über das besetzte Paris bis in die neue Heimat im Norden Londons. Mit Was du nicht erzählt hast gelingt ihm etwas Außergewöhnliches: ein berührendes Familienmemoir, das zugleich die wechselhafte Geschichte eines ganzen Jahrhunderts erzählt.
Pressestimmen
Das Familienmemoir eines großen Historikers.
Orhan Pamuk
Was Vater Bill nicht erzählt hat, erzählt der 60-jährige Mazower in großer Dichte, souverän über Stoff, Sprachen und Epoche gebietend.
Elisabeth von Thadden, DIE ZEIT
Mark Mazower gelingt es detailreich, eine verschattete Traditionslinie der jüdischen Arbeiterbewegung in Osteuropa lebendig zu machen.
Judith Leister, Neue Zürcher Zeitung
Faszinierend und gelehrt zugleich.
The Guardian
Mark Marzower richtet nicht. Es ist die größte Form des Respekts, die er den Menschen, über die er schreibt, entgegenbringen kann.
Geschichte der Gegenwart
Mazower berichtet vom Streben nach Zufriedenheit in der Fremde, von Widerstandskraft und Individualität, von beständigen familiären Werten auch angesichts politischer Erdbeben und gesellschaftlicher Umwälzungen. Darin, legt er überzeugend dar, sei Heimat zu finden, und nicht bloß in der Geographie.
Carsten Hueck, Deutschlandfunk Kultur
Von Stalingrad über Paris bis ins Londonder Exil zeichnet Mazower ein Sittenbild des 20. Jahrhunderts, geprägt von tiefem Humanismus.
NZZ Geschichte Mai 2018
Was du nicht erzählt hast ist ein Buch, das nur einer der besten Historiker schreiben konnte. Es macht Geschichte zu etwas Vertrautem, es macht sie zu etwas Persönlichem.
Michael Greenberg
Eckdaten
Mazower, Mark: Was du nicht erzählt hast - Meine Familie im 20. Jahrhundert
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff
Berlin: Suhrkamp, 2018, 371 S. ISBN: 978-3-518-42811-5
Quelle : www.suhrkamp.de