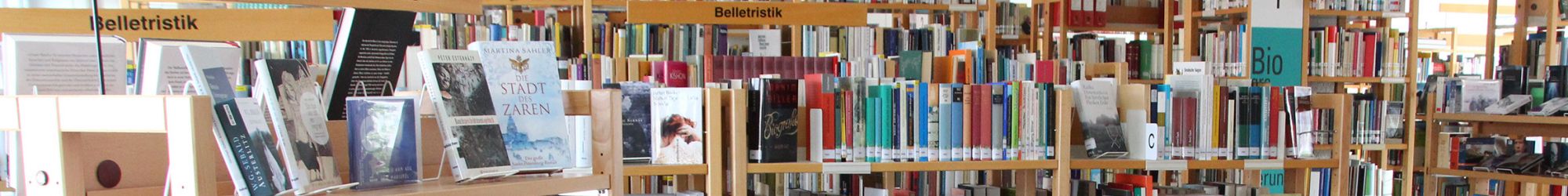Buchtipp des Monats - Sachbuch
Jahresarchiv
- Belletristik
- Sachbuch
2025

Grit Straßenberger
Die Denkerin
Hannah Arendt und ihr Jahrhundert
Hannah Arendt ist die Denkerin des 20. Jahrhunderts. In ihren Schriften wie in ihrem Leben spiegeln sich die tiefgreifenden Erschütterungen dieser Zeit: Aufstieg und Fall totalitärer Regimes, Flucht- und Fremdheitserfahrungen, aber auch hoffnungsvolle Neuanfänge prägten ihr gesamtes Denken. Doch Arendt wollte nicht nur berichten und bezeugen, sondern begreifen. Wie keiner zweiten gelang es ihr, die radikalen Brüche, existenziellen Verlusterfahrungen und unverhofften Chancen des dramatischen 20. Jahrhunderts zu verstehen – und zu leben.
Grit Straßenberger präsentiert ein neues, lebendiges Bild der außergewöhnlichen Denkerin: Durch einen starken Fokus auf die Erinnerungen und Geschichten, die von Freunden, Kollegen und Schülern über Arendt erzählt wurden, lernen wir die Person hinter der einzigartigen Philosophin kennen. Obwohl ihr die Rolle der Intellektuellen zutiefst suspekt war, wurde sie zu einer Intellektuellen von Weltrang. Ihr Denken war irritierend und eigensinnig, sie eckte überall an, war aber alles andere als eine Einzelgängerin: Die Liste von Arendts Bekanntenkreis liest sich wie das «Who is Who» der westlichen Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Arendt führte ihr Jahrhundertleben als eine «Virtuosin der Freundschaft», für deren Denken zwischenmenschliche Verbindungen unverzichtbar waren – und die auch heute noch unsere Freundin im Geiste sein kann.
Pressestimmen
Eine persönliche Annäherung an die große Denkerin, die auch deren Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten nicht verschweigt.
Sachbuch-Bestenliste von ZEIT, ZDF und Deutschlandfunk im November 2025
Das neue Standardwerk.
Platz 3 der Sachbuch-Bestenliste von WELT, NZZ, RBB Kultur und Radio Österreich 1 im November 2025
Ihre Darstellung ist immer sachlich, exzellent informiert, ... durchweg ausgewogen, solide ... Straßenbergers Darstellung meistert die Aufgabe, Arendts Ambivalenz nüchtern herauszuarbeiten.
Wolfgang Matz, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Eckdaten
Grit Straßenberger: Die Denkerin : Hannah Arendt und ihr Jahrhundert. - München : C.H.Beck, [2025]. - 528 Seiten. - ISBN: 978-3-406-83006-8
Quelle: Verlag
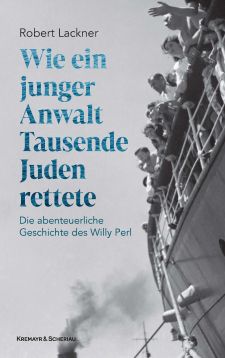
Robert Lackner
Wie ein junger Anwalt Tausende Juden rettete
Die abenteuerliche Geschichte des Willy Perl
Sie kennen Oskar Schindler, aber wissen Sie auch, wer Willy Perl war? Selbst Jude, rettete er mit beispielloser Chuzpe tausende Juden aus Zentral- und Osteuropa vor den Nazis.
Der 1906 in Prag geborene Wiener Anwalt Willy Perl setzte am Vorabend des Zweiten Weltkriegs ein Unternehmen in Gang, das tausende Juden aus Zentral- und Osteuropa vor dem Holocaust rettete. Trotz zwischenzeitlicher Verhaftung durch Gestapo und SS organisierte er mithilfe griechischer Schmuggler heimliche Flüchtlingstransporte über die „umgedrehte“ Balkanroute ins damals britische Mandatsgebiet Palästina.
Robert Lackner zeichnet diese dramatischen Jahre in Perls Leben eindrücklich nach und beleuchtet damit ein wichtiges Stück Zeitgeschichte.
Pressestimmen
… eine locker geschriebene Darstellung, die sich wie eine unglaubliche Abenteuergeschichte liest.
Otto Langels, Deutschlandfunk Andruck
Sachlich und distanziert, sodass das packende Buch, das sich wie ein Krimi liest, mit einem umfangreichen Personenverzeichnis und Cliffhangern zwischen den Kapiteln sowohl wissenschaftlichen als auch literarischen Ansprüchen gerecht wird.
Kleine Zeitung
Ähnlich wie die Geschichte von Oskar Schindler taugt der Stoff, den Lackner über den Spross eines Textilgroßhändlers gekonnt verdichtet hat, auch für die Kinoleinwand.
Ingo Hasewend, Salzburger Nachrichten
Eckdaten
Robert Lackner: Wie ein junger Anwalt Tausende Juden rettete : Das abenteuerliche Leben des Willy Perl. - Wien: Kremayr & Scheriau, 2024. - 299 Seiten. - ISBN 978-3-218-01432-8
Quelle: Verlag
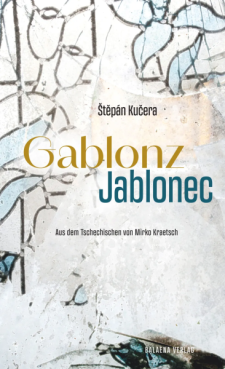
Štěpán Kučera
Gablonz / Jablonec
Im Buch findet sich ein Mosaik von unterschiedlichsten Texten, von Naturbeschreibungen, Zeitzeugenberichten, Zeitungsartikeln, Gedichten, Romanauszügen und persönlichen Reflexionen von Menschen, die das ehemalige Gablonz und das heutige Jablonec über Jahrzehnte hinweg geprägt haben.
Dass dabei auch Peru, Südafrika und Jamaika, Taschkent, Rockville (Maryland) und Bombay eine Rolle spielen, ist vielsagend: Die Weltgeschichte hat in der vermeintlich abgelegenen Stadt zwischen hohen Bergen durchaus Spuren hinterlassen. Aber auch Gablonz/Jablonec und die Isergebirgsgegend haben überraschend vielfältig und nachhaltig in die Welt hinaus gewirkt. Dass wir dies nun detailliert und auf sehr unterhaltsame Weise entdecken können, ist Štěpán Kučeras großes Verdienst.
Eckdaten
Štěpán Kučera : Gablonz Jablonec / aus dem Tschechischen von Mirko Kraetsch. - BALAENA Verlag, 2025. - 271 Seiten. - ISBN: 978-3-911491-02-0
Quelle: Verlag
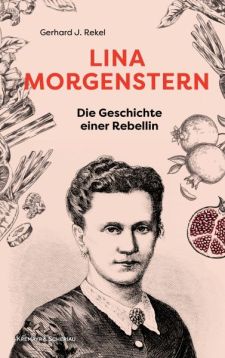
Gerhard J. Rekel
Lina Morgenstern
Die Geschichte einer Rebellin
Für Frauen hat das 19. Jahrhundert Heim, Herd und Gott vorgesehen. Doch Lina Morgenstern stellt sich schon früh gegen diesen Lebensentwurf. Zu ihrem 18. Geburtstag gründet die 1830 in Breslau geborene Lina einen Wohltätigkeitsverein und überredet auf ihrer Feier die Geschäftspartner ihres Vaters mit einer spontanen Rede zu großzügigen Spenden.
Mit 24 heiratet sie gegen den Willen ihrer Eltern Theodor. Als dessen Modegeschäft insolvent wird und die Familie mit fünf Kindern brotlos dasteht, schreibt sie in wenigen Wochen einen Bestseller, während er sich um Haus und Kinder kümmert. Im Preußisch-Österreichischen Krieg gründet Lina mehrere Volksküchen, im Deutsch-Französischen sogar Lazarette – und rettet so tausende Menschenleben.
An Zensur und Patriarchat vorbei initiiert sie die erste Zeitung ausschließlich von Frauen für Frauen und den ersten „Internationalen Frauenkongress“ auf deutschem Boden, der politische Wellen schlägt. In zahlreichen Archiven entdeckte Gerhard J. Rekel neue Details und lässt das außergewöhnliche Lebenswerk einer mutigen Unternehmerin und feministischen Wegbereiterin lebendig werden.
Eckdaten
Gerhard J. Rekel: Lina Morgenstern : die Geschichte einer Rebellin. - Wien: Kremayr & Scheriau, 2025. - 259 Seiten. - ISBN 9-789-3-218-01466-3
Quelle: Verlag
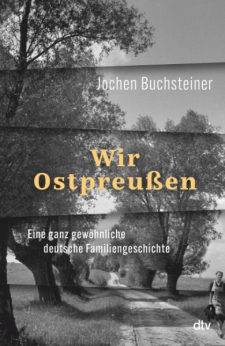
Jochen Buchsteiner
Wir Ostpreußen
Eine ganz gewöhnliche deutsche Familiengeschichte
Der detaillierte Fluchtbericht seiner Großmutter ist Ausgangspunkt für Jochen Buchsteiners Buch über Ostpreußen. Persönlich aber unsentimental verfolgt er den Weg der Gutsbesitzerfamilie in den Westen und spürt dabei dem Verlust nach, der nicht nur den Betroffenen entstanden ist. Es entsteht ein Portrait der fast vergessenen deutschen Provinz, die in ihrer Tragik, aber auch in ihrer historischen und kulturellen Einzigartigkeit sichtbar wird – als verdrängter Teil unserer nationalen Identität.
Zwei Generationen nach Marion Gräfin Dönhoff liefert Jochen Buchsteiner eine Familienerzählung, die einen aktuellen Blick auf die deutsche Vergangenheit wagt.
Eckdaten
Jochen Buchsteiner: Wir Ostpreußen : eine ganz gewöhnliche deutsche Familiengeschichte. - München: dtv Verlagsgesellschaft, 2025. - 285 Seiten. - ISBN 978-3-423-28470-7
Quelle : dtv
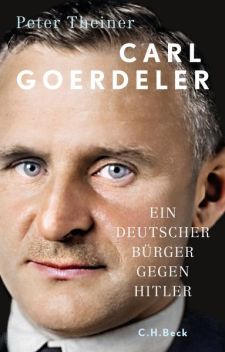
Peter Theiner
Carl Goerdeler
Ein Deutscher Bürger gegen Hitler. Biografie
1884 als Kind einer preußischen Beamtenfamilie in Schneidmühl, Provinz Posen, geboren, ging er den vorgezeichneten Weg vom Jurastudium in die Kommunalpolitik. Aber bereits als Oberbürgermeister von Leipzig versuchte er, das NS-Regime kritisch zu beeinflussen, lehnte konsequent den Eintritt in die NSDAP ab und trat 1936 nach einem antisemitischen Vorfall in Leipzig zurück. Um ihn bildete sich ein Netzwerk des Widerstands, dem sich auch Sozialdemokraten, Gewerkschafter und christliche Demokraten anschlossen. Noch vor dem 20. Juli 1944 wurde er zur Fahndung ausgeschrieben, auf der Flucht denunziert und nach einem Schauprozess hingerichtet.
Stimmen zum Buch
Ein sehr gründliches, quellenbasiertes Buch
Stefan Nölke, mdr Kultur
Fast achtzig Jahre nach der Hinrichtung am 2. Februar 1945 kann man sich durch Theiners biographische Studie auf den neuesten Stand der Forschung über Goerdeler und die Leute des 20. Juli bringen lassen.
Wolfgang Stenke, Deutschlandfunk
Peter Theiners quellengesättigte, überfällige Biografie Goerdelers besticht durch ihre klare Sprache. Der Autor vermeidet sowohl die Heroisierung des Widerstands als auch schlaue Besserwisserei Spätgeborener.
Rudolf Walther, Süddeutsche Zeitung
Eckdaten
Peter Theiner: Carl Goerdeler: Ein deutsche Bürger gegen Hitler. - München: C.H. Beck, 2024. - 496 Seiten. - ISBN: 978-3-406-82146-2
Quelle: Verlag
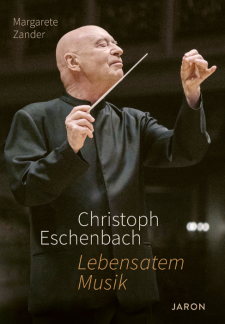
Margarete Zander
Christoph Eschenbach
Lebensatem Musik
Flucht und Vertreibung aus Breslau machten den begabten Jungen mit fünf Jahren zum Vollwaisen. Im Flüchtlingslager verstummt das Kind - und findet seine Sprache zurück durch die Musik. Sie sollte sein Leben werden.
Als Pianist, Kammermusiker und Dirigent eröffnete er den Menschen emotional und intellektuell fantastische Räume; mit Persönlichkeiten wie Herbert von Karajan, Dietrich Fischer-Dieskau und John Neumeier entwickelt er ein ganz eigenes Bild vom Leben mit der Musik. Bedeutende Solisten lieben die Zusammenarbeit mit ihm ebenso wie die Orchestermusiker. Er leitet als Chefdirigent die großen Orchester in Houston, Hamburg, Paris, Philadelphia und Berlin. Wie kaum ein Zweiter entdeckt und fördert er junge Talente. Und immer wieder werden seine Konzerte zu musikalischen Sternstunden. Wie er das macht? Diesem Geheimnis ist das Buch in zahlreichen Geschichten und Begegnungen auf der Spur.
Stimmen zum Buch
Manche Lebensgeschichten wirken wie für ein Drehbuch erfunden. Die des Dirigenten Christoph Eschenbach ist fast Hollywood-reif.
Rita Argauer / BR Klassik
Das Buch ist gründlich gearbeitet und genau, außerdem ist es plastisch in seiner Darstellung – und im besten Sinne unterhaltsam, denn es legt immer wieder auch den Blick frei: auf den Menschen Christoph Eschenbach.
Christoph Vratz / SWR Kultur
Eckdaten
Margarete Zander: Christoph Eschenbach: Lebensatem Musik. - Berlin: Jaron Verlag, 2025. - 264 Seiten. - ISBN: 978-3-89773-180-6
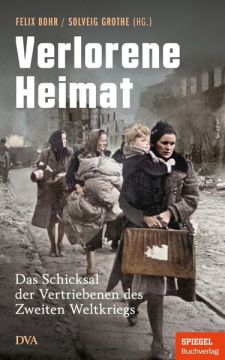
Felix Bohr und Solveig Grothe (Hrsg.)
Verlorene Heimat
Das Schicksal der Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs
Das Thema Flucht beschäftigt die Deutschen nicht erst seit der Aufnahme zahlreicher Menschen aus Syrien und der Ukraine in den letzten Jahren. Denn nie musste Deutschland so viele Flüchtlinge aufnehmen wie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die Vertreibung über 14 Millionen Deutscher aus den einstigen Ostgebieten im Zuge des Zweiten Weltkriegs war die größte gewaltsame Bevölkerungsverschiebung in der europäischen Geschichte. Ein Viertel der bundesdeutschen Bevölkerung hat ein solches Fluchtschicksal in der eigenen Familiengeschichte, auch wenn dazu in vielen Familien lange geschwiegen wurde.
Um diese Erfahrungen und ihre Nachwirkungen sichtbar zu machen, haben die Autoren in der eigenen Familiengeschichte recherchiert, Zeitzeugen gesucht und mit Experten, Historikerinnen und Forschenden gesprochen. Vergessene Erinnerungen an diese Fluchterfahrungen werden freigelegt, doch auch der Blick auf unsere europäischen Nachbarn ausgeweitet und verdeutlicht, dass es diese Vertreibungen ohne die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht gegeben hätte.
Pressestimmen
Ein wertvolles Kompendium, das vergessene Erinnerungen wieder freilegt.
Westdeutsche Zeitung
Als Einführung in die Thematik sehr gut, auch angesichts des Einflusses der Kriegstraumata auf die Gegenwart.
P.M. History
Eckdaten
Verlorene Heimat: Das Schicksal der Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs / herausgegeben von Felix Bohr und Solveig Grote. - München: DVA/Spiegel Buchverlag, 2024. - 240 Seiten. - ISBN: 978-3-421-07040-1

Ira Peter
Deutsch genug?
Warum wir endlich über Russlanddeutsche sprechen müssen
Ira Peter, die mit ihrer Familie als Neunjährige von Kasachstan nach Deutschland umsiedelte, beschreibt anhand ihrer eigenen bewegten Biografie die Erfahrungen und Konflikte der Russlanddeutschen – von der Scham über die sowjetische Herkunft über die fatalen Folgen kurzsichtiger Integrationspolitik bis hin zur »Anfälligkeit« für russische Einflussnahme wirft sie einen kritischen und zugleich feinfühligen Blick auf die von der Mehrheitsgesellschaft oft als fremd empfundenen Deutschen. Sie erklärt, wie die doppelte Diktaturerfahrung unter Stalin und Hitler Russlanddeutsche bis heute prägt und manche anfällig für völkisches Denken macht. Gleichzeitig zeigt Ira Peter, wie heterogen die Gruppe ist und warum »Deutschsein« für sie heute kein Kriterium mehr ist, um deutsch zu sein.
"Deutsch genug?" eröffnet neue Perspektiven auf eine oft missverstandene Gruppe und lädt zum Nachdenken über Geschichte, Identität und Integration ein.
Pressestimmen
Peter schreibt ohne viel Pathos über Verletzungen und Traumata, Eigenheiten und Traditionen, Erfolg und Mut der Russlanddeutschen.
Deutschlandfunk Andruck - Das Magazin für politische Literatur, 24.03.2025
Faktenreich, sehr offen, mit sanfter Ironie und manchmal leichter Bitterkeit. Deutsch genug? Ira Peters Antwort ist vielfältig und lesenswert.
Süddeutsche Zeitung, 22.03.2025
Ein Buch, dessen Lektüre zum Nachdenken über das Miteinander anregt.
Burghauser Anzeiger, 20.03.2025
Eckdaten
Ira Peter: Deutsch genug? Warum wir endlich über Russlanddeutsche sprechen müssen . - Goldmann Verlag, 2025. - 256 Seiten. - ISBN: 978-3-442-31777-6
Quelle: Verlag
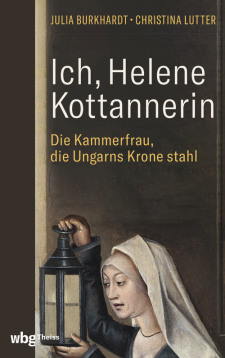
Julia Burkhardt; Christina Lutter
Ich, Helene Kottanerin
Die Kammerfrau, die Ungarns Krone stahl
Nach dem plötzlichen Tod des Habsburgers Albrecht II. im Jahr 1439 wird Helene Kottannerin, Kammerfrau Elisabeths von Luxemburg, von ihrer hochschwangeren Königin beauftragt, die ungarische Krone zu entwenden, um dem ungeborenen Kind des Königspaars die Thronfolge zu sichern. In ihrem autobiografischen Bericht »Ich, Helene Kottannerin« erzählt Helene Kottannerin die packende Geschichte des »Raubs« der Heiligen Krone im Jahr 1440, die Geburt des kleinen Königssohns Ladislaus, die Krönung des zwölf Wochen alten Säuglings und die Flucht mit der Krone im Gepäck.
Um 1450 niedergeschrieben, handelt es sich um die ältesten Memoiren einer Frau in deutscher Sprache. Mit der Übertragung in heutiges Deutsch machen Julia Burkhardt und Christina Lutter nicht nur die Geschichte des »Kronenraubs« einem breiten Publikum zugänglich. Sie geben auch einen außergewöhnlichen Einblick in die Lebens- und Glaubenswelt einer Kammerfrau aus dem 15. Jahrhundert und beleuchten die historischen Hintergründe sowie den Zeitkontext dieses einmaligen Dokuments.
(Klappentext)
„Es ist ein außergewöhnliches Dokument, das uns sehr intime Einblicke in die familiären Strukturen bei Hof gewährt. Und es ist ein unglaublich temporeicher Text, der eine irre Mischung aus großer Politik und kleinen Alltags-Begebenheiten ergibt und eine unglaubliche Dynamik entfaltet.“
Julia Burkhardt im Podcast RADIOWISSEN vom 12.12.2023
Der Podcast RADIOWISSEN des Bayerischen Rundfunks hat der Geschichte der Helene Kottanerin eine Folge gewidmet, die hier abrufbar ist.
Ebenfalls mit diesem „Diebstahl, der die Geschichte Europas verändert“ beschäftigt sich der WDR Zeitzeichen Podcast vom 22.2.2025. Nachzuhören hier.
Eckdaten
Julia Burkhardt; Christina Lutter: Ich, Helene Kottanerin: Die Kammerfrau, die Ungarns Krone stahl. - Darmstadt: wgb Theiss, 2023. - 189 Seiten. - ISBN: 978-3-8062-4567-7
Quelle: Verlag
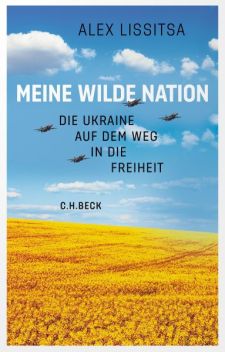
Alex Lissitsa
Meine wilde Nation
Die Ukraine auf dem Weg in die Freiheit
Kiew, 23. Februar 2022: Alex Lissitsa steht vor dem Präsidentenpalast und erhält einen Anruf. Ein Freund vom Geheimdienst ist dran: die Russen, morgen geht es los. Von diesem Moment an ist nichts mehr, wie es war. Es beginnt eine mehr als zweijährige Odyssee durch ein aufgewühltes Land, die mitten hinein führt in den Kriegsalltag der ukrainischen Gesellschaft. Ein Buch voller skurriler Geschichten und berührender Begegnungen, schonungslos offen, aber nicht anklagend, umgeben von Leid und Hass und doch voller Selbstironie und Humor. Ein ukrainischer Weg durch den Krieg, der Sympathie weckt und Hoffnung macht, der aber auch zeigt, was auf dem Spiel steht.
Alex Lissitsa ist der CEO eines der größten Agrarunternehmen und ein intimer Kenner von Gesellschaft und Politik der Ukraine. In diesem Buch erzählt er seinen Weg durch den Krieg. Die Flucht aus Kiew, die Unsicherheit der ersten Wochen. Der Schock, als er in die befreiten Regionen im Norden und Osten des Landes kommt und die Geschichten der Überlebenden hört. Der Kampf um die Rettung seines Unternehmens und der Kampf der Ukraine um Selbstbehauptung und gegen Korruption und alte Strukturen. Gleichzeitig blickt Lissitsa immer wieder zurück und erzählt Geschichte und Gegenwart seiner «wilden Nation». So ist dieses Buch auch ein Porträt der Ukraine und mehr noch der Ukrainer. Es zeigt eine Gesellschaft auf dem Weg nach Westen, nah am Abgrund, aber mit viel Hoffnung – einer Hoffnung, gespeist vom Willen und dem Einfallsreichtum einer Bevölkerung, die sich ihre Chance auf Freiheit und Demokratie nicht nehmen lassen will.
(Klappentext)
Pressestimmen
Die Ukraine aus einer anderen Perspektive. Der Agrarproduzent Alex Lissitsa erklärt sein Land und wirbt um Verständnis für die Geschichte, die Leute und die Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg.
Viola Schenz, Süddeutsche Zeitung
Kann mit dem Blick des Insiders berichten, der weiß, was hinter verschlossenen Türen gesprochen wird.
Jochen Rack, SWR Kultur
Sein Buch räumt mit Mythen auf … Er wolle keine Helden zeigen, sondern die Wirklichkeit normaler Leute ... Lissitsa beschreibt, wie der Krieg sein Leben verändert hat – trotz allem mit Hoffnung und Selbstironie.
Valeriia Semeniuk, Tagesspiegel
Sehr persönliches Kriegstagesbuch setzt nahtlos fort, was Lissitisa seit Russlands Überfall am 24. Februar 2022 tagtäglich tut: die Ukraine zu erklären und für sie zu werben.
Andreas Mihm, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Eckdaten
Alex Lissitsa: Meine wilde Nation: Die Ukraine auf dem Weg in die Freiheit. - München: C.H. Beck, 2024. – 285 Seiten. - ISBN 978-3-406-81409-9
Quelle: C.H. Beck Verlag
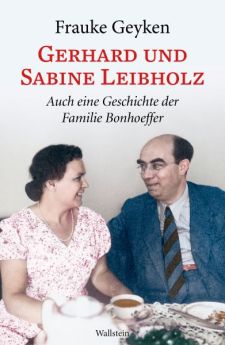
Frauke Geyken
Gerhard und Sabine Leibholz
Auch eine Geschichte der Familie Bonhoeffer
Ausgrenzung und Vertreibung, Exil und Remigration führten zu einem irreversiblen Bruch im Leben des Ehepaars Leibholz – auch in der eigenen Familie Bonhoeffer.
Gerhard Leibholz (1901–1982) war als einflussreicher Jurist und langjähriger Richter am Bundesverfassungsgericht weithin bekannt. Seine Frau Sabine (1906–1999) stand vor allem als Zwillingsschwester von Dietrich Bonhoeffer in der Öffentlichkeit.
Aus einer jüdischen Familie stammend musste Leibholz ab 1933 Ausgrenzung und Zurückweisung erleben, die 1935 in seiner frühzeitigen Emeritierung gipfelte. Begleitet war dies von Demütigungen und Anfeindungen der Familie, auch durch Nachbarn und Freunde.
Die Emigration nach England 1938 bewahrte sie vor weiteren Verfolgungen, der Preis war ein beruflicher und sozialer Abstieg. Erst nachdem die Familie 1947 nach Göttingen zurückgekehrt war, konnten sie zumindest nach außen hin wieder an ihr vorheriges Leben anknüpfen.
Die Historikerin, Frauke Geyken erzählt nun aber weniger die offizielle Erfolgsgeschichte als vielmehr die Geschichte eines Traumas, das das Leben der »Remigranten« bis in die folgende Generation durchzog.
Mithilfe des erstmals zugänglichen umfangreichen privaten Nachlasses kann Frauke Geyken beeindruckend sichtbar machen, was die politischen Verwerfungen der NS-Gewaltherrschaft auch denen angetan haben, die sich retten konnten. Zudem gelingt es der Autorin, einen neuen, vertiefenden und unverklärten Blick auf die gesamte Familie Bonhoeffer und ihre Familienbeziehungen zu werfen.
(Klappentext)
Eckdaten
Frauke Geyken: Gerhard und Sabine Leibolz: Auch eine Geschichte der Familie Bonhoeffer. - Göttingen: Wallstein Verlag, 2024. - 326 Seiten. - ISBN 978-3-8353-5711-2
Quelle: Wallstein Verlag